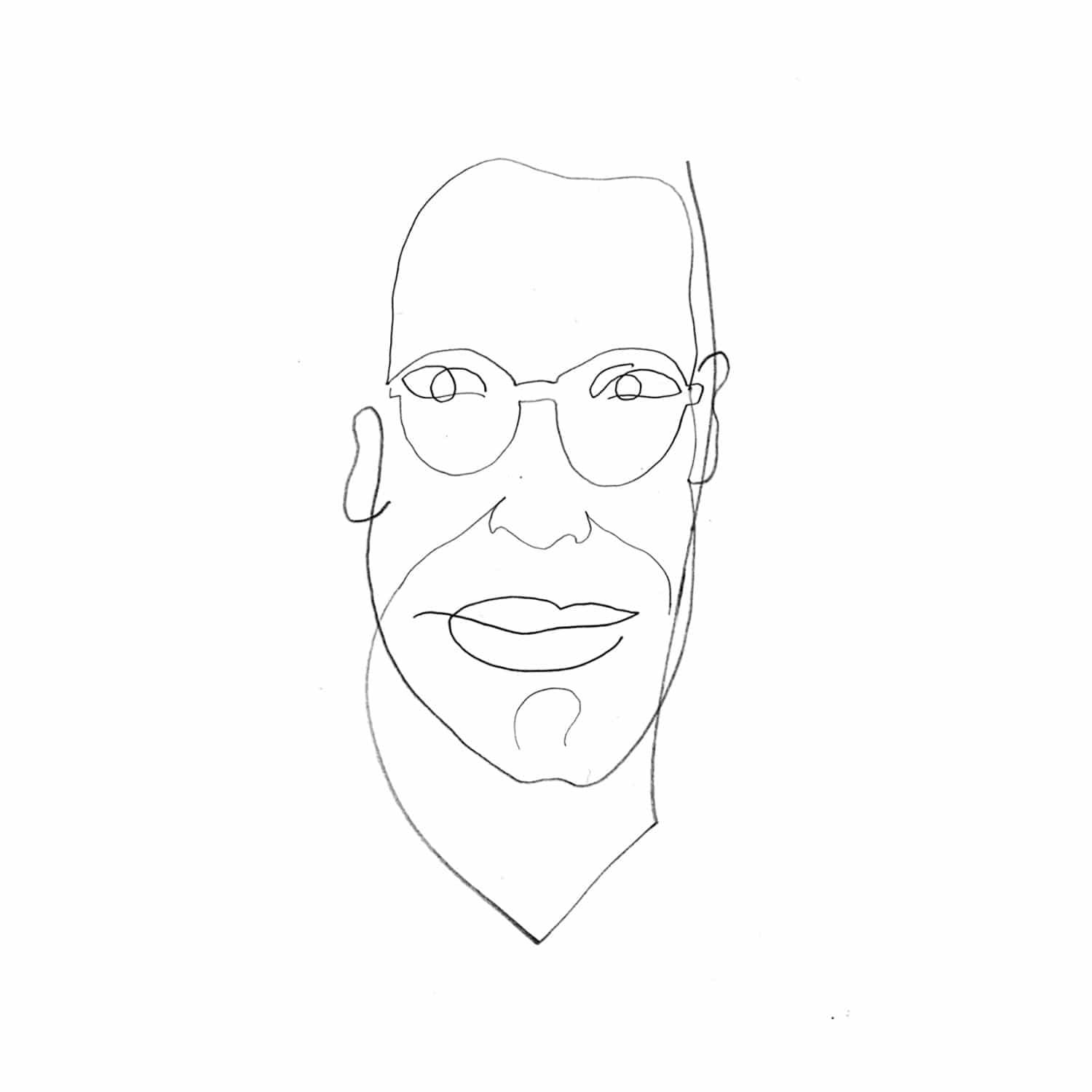Normalerweise bin ich kein Freund architektonischer Schnelllösungen für die großen Probleme der Welt. Wenn Architektur politisch werden will, kommt oft gut gemeinter Projektkitsch heraus. Im FalleEine Falle in der Architektur ist ein Mechanismus, der verwendet wird, um eine Tür, ein Fenster oder eine andere Öffnung in einer Position zu halten oder zu verriegeln. Es handelt sich meist um einen Bolzen oder ähnliches, der in eine entsprechende Aussparung greift. Die Falle verhindert, dass die Tür oder… der momentanen Flüchtlingsdebatte sehe ich das aber anders. Hier kann die Architektur helfen. Und zwar in dem sie Modelle findet, das gestrige Konzept des „Flüchtlingsheimes“ zu überwinden.
Der Bautypus (wenn man davon überhaupt reden kann) Flüchtlingsheim entstammt einer anachronistischen Vorstellungswelt. Hier wir, da „die Flüchtlinge“. Letztere werden als amorphe Masse gesehen, ohne individuelle Prägung, geeint einzig durch das eine, alles andere überdeckende Motiv: die Flucht (oder deren Vortäuschung). Der Realität der Wanderbewegungen nach Deutschland – und aus Deutschland heraus – wird das nicht gerecht. Und auch nicht den Motiven der Migrierenden. Diese sind vor allem eines: heterogen. Weit heterogener jedenfalls als das sowohl die rechten Mobs als auch romantisierende Flüchtlingsversteher wahrhaben wollen.
Dieser Heterogenität gilt es, räumlich zu entsprechen. Die klassischen Flüchtlingsheime zeichnen sich aber durch das genaue Gegenteil aus. Es sind möglichst neutrale Hüllen, die jeden Ausdruck von Individualität zu unterbinden versuchen. Ihre Symbolik ist eine, die den Migrierenden signalisiert: Ihr seid nicht vorgesehen, deshalb haben wir auch keine adäquaten Räume. Es ist das Provisorium als politisches Statement. Auch wichtig: Die Heime befinden sich möglichst weit ab von den kulturellen Kernströmen der Gesellschaft. Dahinter steckt die Sehnsucht nach einer klar geordneten Welt, in der möglichst wenig die Routinen des städtischen Zusammenlebens stört.
Genau das aber ist naiv. Die vernetzte Welt von heute ist eine der ständigen Störung. Routinen sind gewissermaßen dazu da, um gestört zu werden. Auch die Zusammensetzung von Gesellschaft ist permanent der Störung, oder besser: der Transformation durch innere oder externe Krisen ausgesetzt. Die Konstruktion von binären Gesellschaftsordnungen – hier „wir“, dort „die Migranten“ funktioniert nicht mehr. Gesellschaft ist porös. Und sie muss das auch sein. Unterbringungskonzepte für Migrierende sollten dies reflektieren. Sie sollten Möglichkeiten der Begegnung möglichst unterschiedlicher gesellschaftlicher Schichten schaffen und selber das Temporäre in sich tragen. Sie sollten sich trauen, die Realität der Wandernden mit den Lebenswirklichkeiten der europäischen Gesellschaft nicht nur zu konfrontieren, sondern zu verweben. Sie sollten Wanderungen als gesellschaftliche Normalität behandeln.
Unsere Gesellschaft muss verstehen, dass sie eine durch die unterschiedlichsten Wanderungsbewegungen geprägte ist und auch bleiben wird. Die Jahrzehnte alte Debatte darüber, ob Deutschland ein EINwanderungsland ist, wirkt vor diesem Hintergrund gestrig. Fakt ist: Wir sind ein WANDERUNGSland. Wir sind eine Wanderungsgesellschaft. Räumliche Mobilität ist – auf allen Ebenen der Gesellschaft – der Normalfall. Die Menschen in Europa müssen das aushalten können – auch wenn es heißt, ein Mehr an Heterogenität und Komplexität zu akzeptieren. Und auch wenn es bedeutet, von bestimmten Vorstellungen stadträumlicher Ästhetik Abstand zu nehmen. Nein, man muss, anders als es die traditionslinke Diskursroutine will, nicht jede urbane Raumnahme durch Menschen aus anderen Kulturkreisen als authentisch und schön feiern. Aber man sollte dazu in der Lage sein, mit solchen städtischen Überraschungsmomenten, in denen man mit der Realität der Globalisierung konfrontiert wird, umzugehen.
Das Nachdenken über die stadträumliche Übersetzung dieser Realität führt dazu, dass man scheinbar vertraute Orte neu liest. Man sieht, wie Menschen mit anderem kulturellem Hintergrund sie verstehen. Und man klopft sie auch selber auf ihr Potenzial für eine Wanderungsgesellschaft hin ab. Hier werden dann auch die oft naiv wirkenden politisch motivierten Masterarbeiten deutscher Architekturfakultäten interessant. Ein (willkürliches) Beispiel: Die Universität Hannover ließ Studierende alternative Raumkonzepte für Flüchtlinge entwerfen. Das ist, vor dem Hintergrund meiner Argumentation, tatsächlich eine spannende Übung. Weil sie hilft, die Fluidität des städtischen Raumes als Potenzial zu entdecken. Weiter gedacht, könnte dies zu einer permanenten Neuaneignung urbaner Infrastruktur für alle möglichen sozialen Problemlösungen führen.