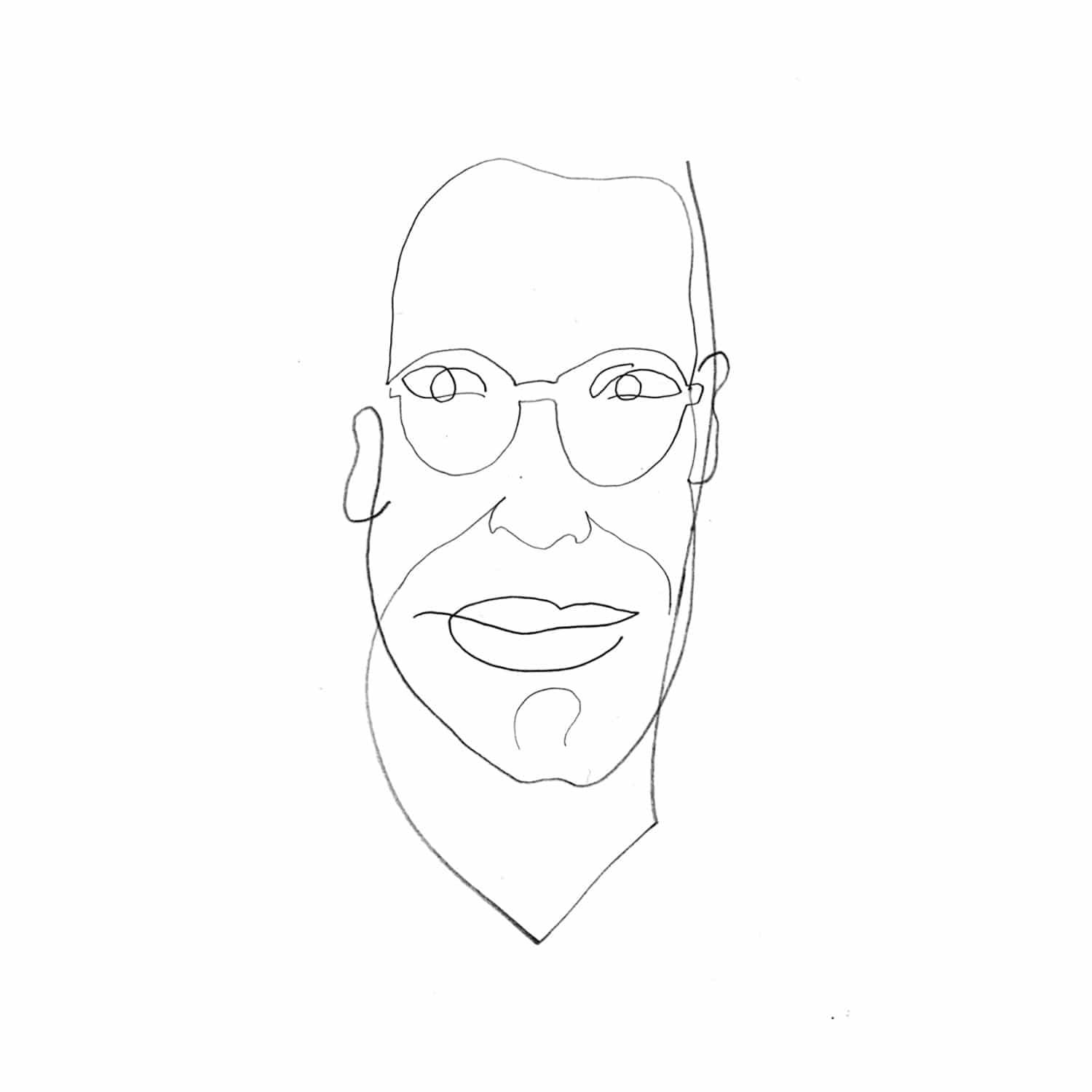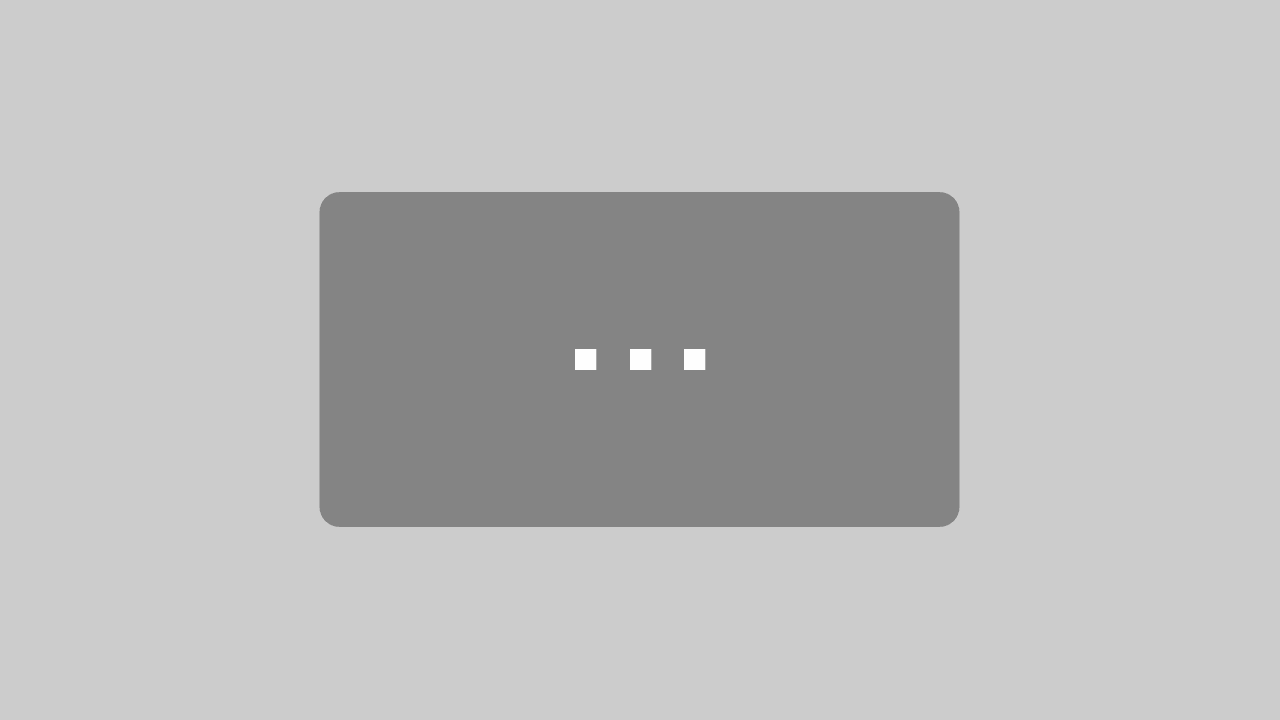Bildschirme tauchen in Filmen auf
Zelluloid und Beton – schon immer herrschte eine wechselhafte Symbiose zwischen den Welten des Films und der Architektur. Speziell Filme, die mit dem Unbehagen der Zuschauer spielen, bedienen sich des gebauten Raums – etwa Dario Argentos legendärer Horrorstreifen „Suspiria“. Die Architektur wird dabei selbst zum Schauspieler. Behagen dürfte ihr das nicht immer.
Dass Architektur und Film zusammengehören, wissen wir. Schon in der Frühzeit der bewegten Bilder arbeiteten diese architektonisch. Denken wir an die Klassiker des Expressionismus wie „Das Cabinet des Dr. Caligari“ (1919). In gewisser Hinsicht waren frühere Filme sogar stärker von räumlichem Umfeld geprägt als die Filme oder Qualitätsserien von heute. Weil das Räumliche durch seine Kulissenhaftigkeit damals anders sichtbar war: Die Kulisse war immer als Kulisse erkennbar. Der Zuschauer wurde so auf die Materialität und die Räumlichkeit des Mediums Film zurückgeworfen. Treiber dieses Effekts war gerade die Fragilität, die den Filmräumen von damals anhaftete.
Epochenübergreifend aber heißt das: Die Architektur ist für den Zuschauer von Filmen immer präsent. Einen weiteren Twist erfährt das Verhältnis von Architektur und Film in dem Moment, in dem Gebäude explizit zu einem Akteur im Film werden. Hier öffnet sich eine Welt der Doppeldeutigkeit des Räumlichen. Architektur ist nun nicht mehr nur in sämtlichen Kulissen präsent, sondern übernimmt als Darstellerin ihrer selbst eine Doppelrolle. Auch diese war gerade in stilprägenden frühen Filmen überaus beliebt. Nehmen wir „Metropolis“ von Fritz Lang (1927). Offensichtlich ist dies ein Film, dessen Hauptdarsteller Architektur ist: Die Architektur einer schnellen, brutalen, düsteren Zukunft. Das offenbar Kulissenhafte der gezeigten Hochhausschluchten nimmt den Bildern nichts von ihrer Eindrücklichkeit. Im Gegenteil: Die Surrealität der gezeigten Metropole (ober- wie unterirdisch) unterstützt sogar die Bedrohung, die von diesem Film ausgeht. Diese Stadt der Zukunft ist nicht wirklich. Zu befürchten ist jedoch, so der Subtext des Films, dass sie dennoch real werden könnte.
Mit der Kombination von Architektur und Film wird in vielen Filmen die politische Struktur des Mediums selbst reflektiert. Film ist politisch – das wird häufig durch die Präsenz von Bildschirmen in architektonischen Räumen demonstriert. Architektur hat danach einerseits das Potenzial, gegen sinistre Mächte Schutz zu bieten, sie wird aber selber zugleich von diesen Mächten infiltriert. Dies geschieht eben vor allem dann, wenn sie zum Träger von filmbezogenen Technologien wird, von Kameras oder Bildschirmen. Film macht die Architektur böse – das ist es, was uns viele in Sachen Architektur oder Kulturkritik ambitionierte Filmklassiker wie „Blade Runner“ (1982), „Total Recall“ (1990) oder „Truman Show“ (1998) zeigen. Aber auch in Metropolis hingen bereits überdimensionierte Bildschirme an den Wänden. Oder vielmehr, sie bildeten die Wände. „Der Wand-Bildschirm ist sowohl Symbol als auch eine sehr konkrete Technologie der technokratischen Macht“, schreibt der Kulturkritiker Scott McQuire in einer Abhandlung über das Verhältnis von Medium und Stadt.
Architektur als Zusatzebene
Das Beispiel Metropolis verdeutlicht zugleich einen anderen Zusammenhang, um den es an dieser Stelle, passend zum Heftthema, gehen soll: jenen zwischen Filmarchitektur und dem Konzept des Unheimlichen. Man könnte sagen, dass die Präsenz von Architektur in Filmen immer etwas Unheimliches transportiert. Nicht nur in Horrorfilmen. Architektur verleiht Filmen eine zusätzlich unheimliche Ebene. Sie stiftet als eigentlich medienfernes Element in Filmen ein Gefühl von Bedrohung und Eingesperrtheit, von Enge oder von Gefahr für die räumlich-familiären Schutzzonen. Und sie wird selber gern mit einer Ebene des Unheimlichen versehen.
Als wesentliches Vehikel hierzu dient der Filmausschnitt. Die Logik dabei ist Folgende: Filme sind ihrer Natur nach räumlich begrenzt – durch den Bildschirm. Genau hier liegt ein Gegensatz zu unserem Verständnis von „guter“, qualitätvoller Architektur. Diese nämlich zeichnet sich durch ein hohes Maß an (stadt-)räumlicher Integration und Kontextbezogenheit aus. Gute Architektur weitet den Blick, Filmarchitektur verengt ihn. Insofern ist Architektur im Film immer defizitär: Weil sie sich nicht städtisch integriert, gar nicht integrieren kann. Der Film reduziert Architektur auf ihr Ornamentales, ihre zeichenhaften Effekte. Er macht aus ihr insofern etwas Unsoziales, ein Stück ungeheurer Aggressivität.
Sehr deutlich wird dies im Werk des Filmemachers David Lynch. Seine architektonischen oder städtischen Räume transportieren immer den vollen Horror des isoliert gebauten Raums. Nehmen wir das zentraleZentrale: Eine Zentrale ist eine Einrichtung, die in der Sicherheitstechnik als Steuerungszentrum für verschiedene Alarmvorrichtungen fungiert. Sie empfängt und verarbeitet Signale von Überwachungseinrichtungen und löst bei Bedarf Alarm aus. Gebäude in „Lost Highway“, ein modern inspirierter, gleichwohl auch postmodern und brutalistisch schillernder Traum. Ein Traum jedoch, der im Zuge des Films ziemlich schnell und konsequent zum Alptraum mutiert. Eigentlich ist diese Villa in Hollywood, die im Original übrigens von Lynch selbst entworfen wurde und bewohnt wird, ein ziemlich ansprechender Bau. Doch ihr tendenzieller Modernismus der Form entwickelt im Zuge der Erzählung seine eigenen Horrorelemente.
Klaustrophobische Räume
Es wird eng in diesem Haus, und klaustrophobisch. Vor allem dekonstruiert der Film die Idee eines Gebäudes als schützende Hülle. Er öffnet das Gebäude gewaltsam. „Ich bin in Ihrem Haus“ ist ein Kernsatz des Films: Der Hauptfigur werden Videos geschickt, die in seinem Haus aufgenommen wurden.
In gewisser Hinsicht zeichnet Lost Highway damit eine der zentralen Zumutungen nach, die die moderne Architektur mit ihrem Wunsch nach TransparenzTransparenz: Transparenz beschreibt die Durchsichtigkeit von Materialien wie Glas. Eine hohe Transparenz bedeutet, dass das Material für sichtbares Licht durchlässig ist. für den Menschen darstellt. Schließlich will diese Architektur nicht nur „klar“ und „hell“ sein, sondern vor allem auch „transparentTransparent: Transparent bezeichnet den Zustand von Materialien, die durchsichtig sind und das Durchdringen von Licht zulassen. Glas ist ein typisches Beispiel für transparente Materialien.“, „offen“ und „kommunikativ“. Sie entkleidet sich damit womöglich ihrer Schutzfunktion.
Suspiria: der ultimative Raum-Horrorfilm
Eine Schutzfunktion, die sie in den Filmen des italienischen Regisseurs Dario Argento nie hatte. Deutlich wird dies vor allem am Film „Suspiria“ (1977), einem brillanten, grellen Giallo-Werk über eine Hexe, die in einer sehr alten Ballettschule ihr Unwesen treibt. Argento leitet die irre Hyperkonsum-Atmosphäre der 1980er-Jahre ein – indem er den ultimativen Raum-Horrorfilm kreiert. Die Geschichte spielt in einem Freiburger Mädchen-Tanzpensionat. Eine amerikanische Tänzerin kommt nach Old Europe und muss bemerken, dass dieses ganz und gar nicht „good“ ist – sondern eben von einer Hexe besessen. Diese taucht mit ihrer Präsenz das Pensionat, in dem die Handlung weitgehend spielt, in eine fantastisch gespenstische Aura. Argentos Regie und die schnelle, fast irre Kameraführung von Luciano Tovoli untermalen dies.
Argento baut Freiburg nach
Für Argento war die Idee des Städtchens Freiburg im Breisgau offenbar der Inbegriff des Unheimlichen. Allerdings musste er das Mädchenpensionat im Studio in Italien nachbauen. Die dramatisch rote FassadeFassade: Die äußere Hülle eines Gebäudes, die als Witterungsschutz dient und das Erscheinungsbild des Gebäudes prägt. hätte man sonst so „bloody“ kaum hinbekommen. Und das, obwohl es mit dem „Haus zum Walfisch“ sogar ein reales gebautes Vorbild gab.
Um die Dramatik der Bildeffekte zu steigern, setzt der Regisseur ein schon zu Drehzeiten antiquiertes Filmmaterial ein: die „IB-Technicolor“ von Kodak. Diese überzeichnet FarbenFarben: Verschiedene Empfindungen, die durch Licht unterschiedlicher Wellenlänge erzeugt werden., was speziell der Architektur und den Außenaufnahmen etwas Hysterisches verleiht. Auch hier wieder vergeht sich der Film, in diesem Fall die Materialtechnik, am gebauten Raum, benutzt diesen und vergewaltigt ihn in gewisser Hinsicht auch.
Mit noch einer ganz anderen Form der Vergewaltigung verging sich Argento an seinen Schauplätzen und Drehorten. Denn das Freiburg im Film ist in Wirklichkeit gar nicht Freiburg. Es ist auch kein Studio-Ort. Was wir sehen, ist München. Die meisten Außenszenen, die Freiburg darstellen sollen, wurden faktisch in München gedreht. Das Hofbräuhaus dient als Kulisse, der Königsplatz, ebenso das BMW-Hochhaus von Karl Schwanzer. Eine interessante und wiederum ganz und gar nicht „heimelige“ Ortswahl. Es scheint, als böte die frühere Hauptstadt der Bewegung viel fantasmagorisches Potenzial, was sie als Kulisse für einen Horrorfilm besonders auszeichnet.
Technoides Schaudern
Und das offenbar nicht nur wegen ihrer düsteren Butzenscheibenhaftigkeit. Der Schwanzer-Hochbau ist schließlich etwas ganz anderes. Das Gebäude ist modern und architektonisch über jeden Zweifel erhaben. Hier manifestiert sich kein Unbehagen am deutschen Ungeist, sondern allenfalls ein Schaudern angesichts der technologieaffinen Effizienzwelt des Nachkriegsdeutschland.
Zugleich liegt genau in der Art, wie Argento die eine Stadt für eine andere ausgibt, ein spezielles Stück Horror: Die moderne Architektur ist für ihn anscheinend ein Chamäleon. Ihr Schrecken liegt in ihrer Ortlosigkeit. Jeder Ort kann jeden anderen spielen. Die Moderne macht aus Städten Method Actors, rollenflexible Darsteller ihrer selbst.
Ein Gedanke, der seinerseits prophetisch ist. Denn was wir heute erleben, ist oftmals eine drastische Steigerung von Argentos Methode. Es ist die architektonische Schauspielerei in Reinkultur. Das allerdings nicht zuletzt dort, wo die Ideen der Moderne zugunsten eines vermeintlich „menschlicheren“ oder geschichtsreicheren Baustils hintan gestellt wird. Wenn bald am neu-alt gebauten Frankfurter Römer die Giebeldächlein ihr historisierendes Ballett aufführen, tut einem das Frankfurt von heute eher leid, weil es seine Rolle in diesem baulichen Historienschinken spielen muss. Zu schwer und damit unzeitgemäß ist dieser Stadtfilm. Wenn schon vom echten Film lernen, so möchte man dieser filmischen Architektur zurufen, dann doch bitte von komplexeren Erzählungen – zum Beispiel eben von jenen eines David Lynch oder Dario Argento.
Räume werden gedoppelt
Um dem Verhältnis von Architektur und Film systematisch näher zu kommen, zitiert der Filmwissenschaftler Vinzenz Hediger den Philosophen Gadamer. Der „hat für den Umgang mit Architektur den Begriff des Begehens vorgeschlagen“, so Hediger. Dieses Begehen sei aber im Zeitalter des Internet ein ungeheures Wagnis. Worin das Wagnis liege, das spiegele sich besonders in Science Fiction-Filmen. „Das Spiel mit der Doppelung der Räume, mit der Fortsetzung des Raumes hinter einer symbolischen und technischen MembranMembran: Eine Membran ist ein dünnes, dehnbares Material, das in der Architektur für die Überdachung von Freiflächen oder als Fassadenelement eingesetzt werden kann., die die Grenze zwischen dem normalen urbanen Raum und dem Science-Polizei-Raum markiert, ist eine Erfahrungsschwelle, die uns offenbar in dem Zeitalter, in dem wir leben, besonders vertraut vorkommt“, so Hediger. Das heißt: Wir laufen immer Gefahr, dass ein solcher „Science-Polizei-Raum“ entsteht.
Raum ist im Film von heute nicht unschuldig. Und die Architektur auch nicht. Sie ist flexibel. So flexibel, dass sie im Film in immer wieder andere Rollensind kleine bewegliche Teile, die in Türschlössern verbaut werden, um die Beweglichkeit der Türverriegelung zu verbessern. Sie können in verschiedenen Ausführungen und Materialien vorkommen. schlüpfen kann. Und so flexibel, dass sie im echten Leben ebenso von sinistren Mächten potenziell immer wieder missbraucht wird.
Man kann von daher der Architektur von heute nur raten, Widerstandskräfte zu entwickeln. Das wird sie vor der filmischen Verarbeitung nicht schützen. Aber vor der Auflösung des real gebauten Raums durch die mediale Duplizierung.
Dieser Beitrag erschien zuerst in Baumeister 02/2015: Unbehagen.