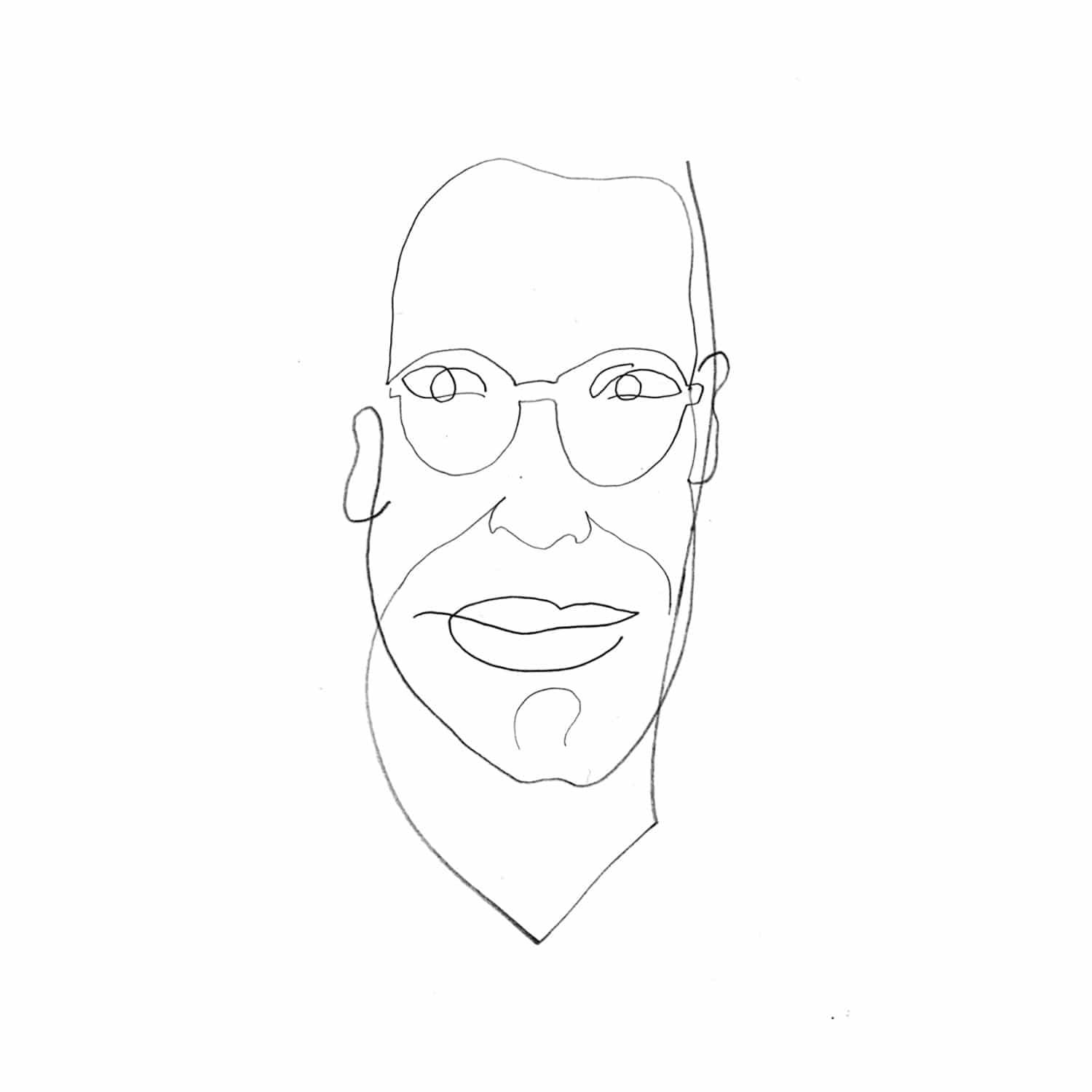Die Bilder sind ungemein ästhetisch, nicht nur abends aus dem Flugzeug: Mit einer visuell beeindruckenden Installation zeichnet Berlin 25 Jahre nach Grenzöffnung den Verlauf der Berliner Mauer nach. Auf einer Strecke von 15,3 km markieren tausende weiße Ballons die ehemalige innerstädtische Position des absurden Gebildes. Zwei Tage und Nächte lang teilt die temporäre Installation die Stadt innerhalb des S-Bahn-Rings wieder in Ost und West.
Gerade weil sie aber ästhetisch ist, wird die Installation „Lichtgrenze“ in den sozialen Medien kritisiert. Darf man einen Zugang zum Grauen der Mauer finden, der Assoziationen wie „schön“, „anmutig“ oder „großartig“ hervorruft? Einige finden: nein. Ich entgegne: Natürlich. Muss man sogar. Und zwar nicht im Sinne der Ästhetik als reiner Gegenstrategie, als demonstrativ „schönes“ Statement gegen das nur Hässliche. Sondern als Verständnismechanismus. Was ich meine: Die DDR, wie banal auch immer, hatte auch ihre eigenen Ästhetiken, ihre eigenen emotionalen Spezifika. Die Bewohner der ostdeutschen Republik haben sich mit ihrem Land ästhetisch auseinander gesetzt. Ästhetik ist nicht nur Schönheit. Und genau deshalb ist ein visuell-ästhetischer Akzent zum Mauerfall richtig und konsequent. Natürlich sind auch Dokumentationen und Filmausschnitte wichtig, die den realen Schrecken an der Mauer und das Leben in beiden teilen der Stadt dokumentieren. Aber die emotionale und emotionalisierende Aufgeladenheit der temporären Installation verleiht dem Gedenken an den Mauerfall eine zusätzlich bild- und affektstarke Ebene. Eine Ebene, die mich auch erneut an die schwedische Künstlerin Eija-Riitta Eklöf-Berliner-Mauer erinnert. Die Modellbauerin behauptet nämlich in einer Strategie hysterisch-kluger Ernsthaftigkeit, mit der Berliner Mauer verheiratet zu sein.
Die letzige Berliner Installation wirft zugleich auch eine architektonisch interessante Frage auf. Jene nämlich, ob die Mauer überhaupt Architektur war. Klar, der Steinwall war ein Bauwerk. Aber er hat keinen Schutz gewährt – zumindest sollte er keine Menschen schützen. Die Mauer schützte ein Unrechtsregime vor der Unterminierung durch soziale Mobilität der DDR-Bürger. Insofern ist sie eher ein Anlass, über die Grenzbereiche von Architektur nachzudenken und darüber, was mit einer Kaperung des architektonischen Formen- und Funktionskanon alles angerichtet werden kann.
Die Mauer war auch der Inbegriff architektonischer Mittäterschaft. Als gebaute Realität ist sie bis heute der Inbegriff des „schuldigen“ Bauens. Und ein Ausdruck für die Tatsache, dass es die unschuldige Architektur nicht gibt – am allerwenigsten in Unrechtsstaaten wie der DDR. Architektur ist immer politisch. Im übrigen natürlich auch in demokratisch verfassten Staatsgebieten. Insofern sollten wir auch unsere Gebäude immer daraufhin hinterfragen, welchen Beitrag sie zur gesellschaftlich-politischen Verfasstheit unseres Lebens leisten. Und, härter formuliert, welche Grenzen zwischen Ländern, Personengruppen oder Lebensentwürfen auch bei uns architektonisch gezogen werden. Wenn die Initiatoren Christopher Bauder und Marc Bauder mit ihrer temporären Berliner Lichtgrenze diese Überlegungen aufs Tablett heben konnten, haben sie viel erreicht.
Bild: © Kulturprojekte Berlin / Foto: Alexander Rentsch