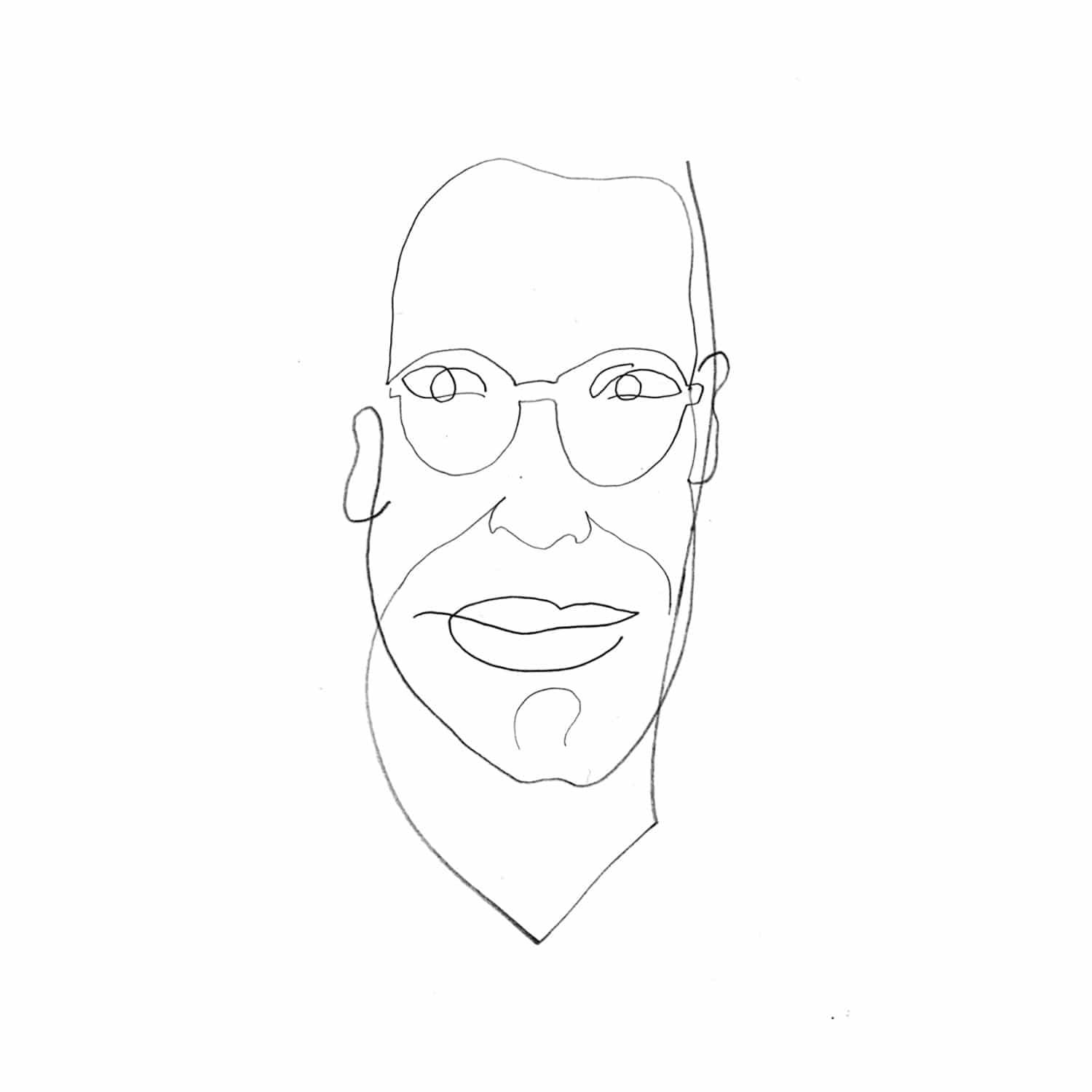Während ich dies schreibe, sitze ich auf der Terrasse eines Hotels. Irgendeines Hotels. Ich sitze hier nicht, weil ich will, sondern weil ich muss. Ich warte nämlich auf meine Mitreisenden. In diesem Fall. Es könnte aber auch jemand anderes sein, dessen An- oder Zurückkommen ich entgegenfiebere. Kollegen, Interviewpartner. Irgendwer. Entscheidend ist: Ich warte.
Das mache ich oft. Sie sicher auch. Ich würde mal schätzen, dass wir eine Stunde pro Woche wartend verbringen. Das Warten ist insofern eine Kerntätigkeit des modernen Menschen. Was aber eigentlich absurd ist. Denn wer wartet, der ist ja nicht produktiv. Erklären Sie mal Ihrem Boss, dass Sie eine Stunde lang reglos am PC sitzen, weil Sie auf etwas warten müssen. Der verabreicht Ihnen einen Tritt in die Lehne des Bürostuhls. Wartende sind in der Welt der Arbeit Verlierer. Sie haben ihren Tag nicht im Griff oder ihre Umgebung, die sie „warten lässt“. Der Wartende stellt einen Widerspruch zur Hochleistungs-Gesellschaft dar.
Allerdings hat das Warten seine eigenen sozialen und räumlichen Codes. Gerne kombiniert wird die Tätigkeit des Wartens zum Beispiel mit dem Schlangestehen. Man formiert sich in der Schlange in einer geordneten Wartekonstellation. Diese stellt einen interessanten Widerspruch dar: Sie antizipiert nämlich in ihrer Form ihr eigenes Ende. Die Warteschlange repräsentiert vorab den Prozess ihrer Selbstauflösung – weil sie anzeigt, in welcher Reihenfolge ihre Mitglieder aus der Schlange ausscheren dürfen.
Dafür, dass wir so viel warten, hat die Architektur die Wartenden lange schmählich im Regen stehen lassen. Oft auch wörtlich gesprochen. Auf deutschen Provinzbahnhöfen zum Beispiel.
Oder denken wir an Flughäfen. Der Flughafen ist der Ort, an dem so viel gewartet wird wie nirgendwo sonst. Es überrascht mich immer wieder, dass das so wenig bedacht wird bei der Flughafenplanung. Tag für Tag bringt von JFK bis Frankfurt das Anschwellen einer wartenden Gruppe zur Masse die ordnende Logistik der Hausherren zum Einsturz. Terminal 2 in London-Heathrow zum Beispiel ist ein Ort des permanenten Kollapses. Ausgerechnet im Epizentrum des Finanzkapitals kollabiert regelmäßig die Mobilitätsgesellschaft, weil sie die Stagnation des Wartens nicht mitgedacht hat.
Ist das Warten also das schwarze Loch der Architektur? Zum Glück nicht nur. Vergangenes Jahr kuratierte Dietmar Steiner im österreichischen Krumbach die bezaubernde kleine Raumschau „BUS:STOP“. Sieben bekannte Architekturbüros hatten Bushäuschen entworfen. Die waren vielleicht nicht immer praktisch, aber ausgesprochen schön. Sie stellten raffinierte Interventionen in die Bregenzwälder Umgebung dar.
Aber ist das Warten nun eigentlich nutzlos? Knallharte Performance-Ethiker mögen das denken. Kapitalistische Raumplaner sind zumindest gut darin, Wartezeiten mit Konsumangeboten zu überfrachten. Auch das kennen wir von Flughäfen. Die werden heute in Shoppingmalls mit Flugsteig verwandelt. Dass das die Architekten an ihre Grenzen führt, davon können die Flughafenbauer von gmp ein Lied singen.
Eine ganz andere Form der Produktivität sieht in unseren innerstädtischen Wartezonen – und im Prozess des Wartens an sich – der Kulturtheoretiker Jonathan Crary. In seiner lesenswerten Polemik „24/7: Late Capitalism and the End of Sleep“ interpretiert er das Warten als subversiven Akt. Und es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen: Wer einfach nur auf etwas wartet, der verweigert sich der Leistungsgesellschaft. Er schafft keinen Wert, sondern schaut nur umher. Am besten gleichmütig, nicht leistungsethisch gehetzt. Und er nimmt sich vielleicht sogar noch die Freiheit, die Hektik um ihn herum kritisch zu reflektieren. Crary zumindest hält dies für möglich.
Mit meinem Verhalten hier auf der Hotelterrasse wäre er von daher eher nicht zufrieden. Schließlich habe ich einen Weg gefunden, touristische Warte- in journalistische Produktivzeit umzuwandeln. Verfluchte Welt der neuen Medien.