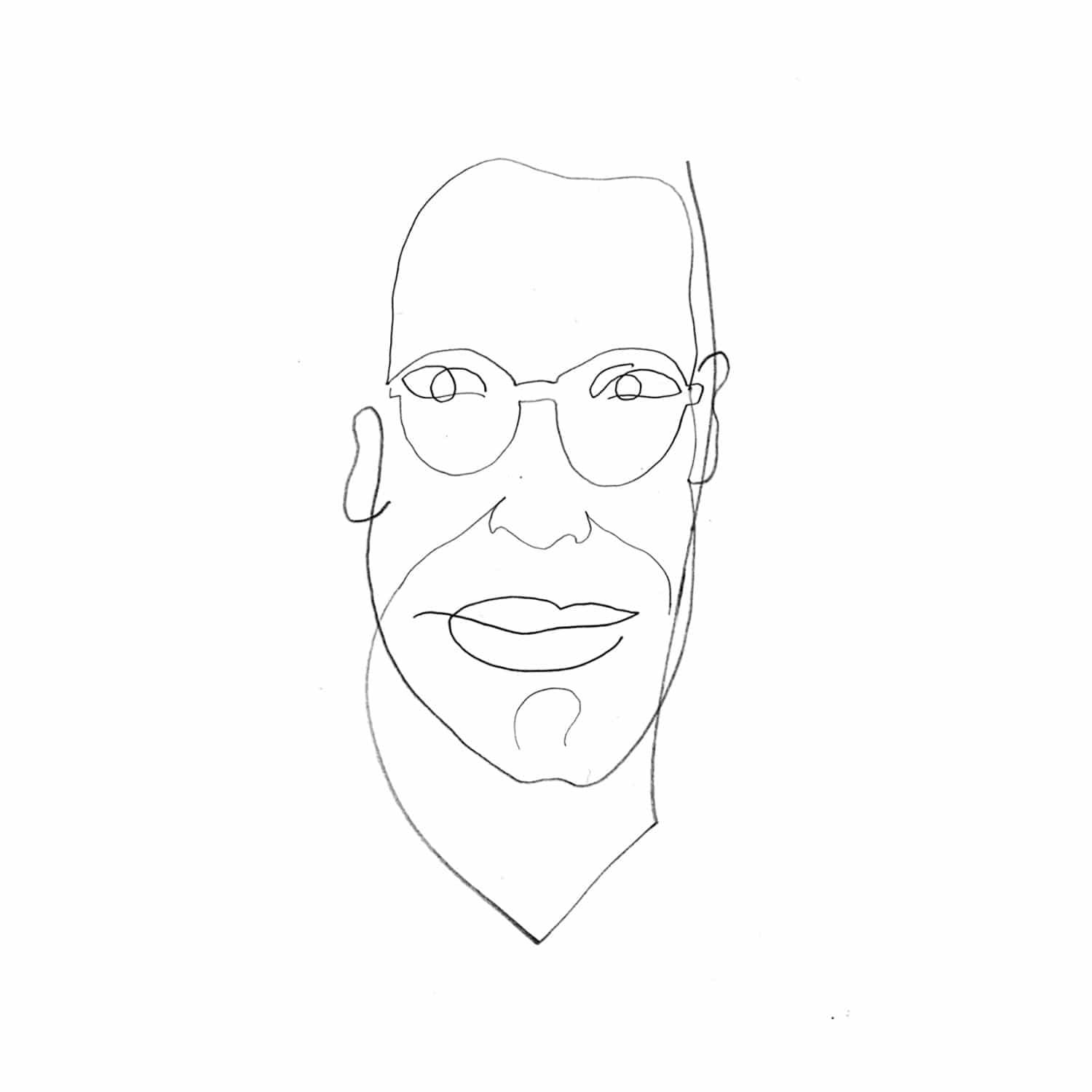Der emotional und politsymbolisch vielleicht aufgeladenste Begriff unserer Tage ist der der „Grenze“. Grenzen beschäftigen uns. Wir gucken auf unsere diversen Außengrenzen. Wir fragen uns, ob sie „halten“. Wir denken drüber nach, neue Grenzen zu errichten oder obsolet gewordene zu reaktivieren.
Dabei ist mit der Ziehung einer Grenze noch nicht viel erreicht – vor allem nicht das Ende von Mobilität. Im Gegenteil: Eine Grenze bringt immer ein neues Mobilitätsregime mit sich. Grenzen kanalisieren Mobilität, aber sie erzeugen sie auch.
Der ultimative Ein- und Ausschluss, der (vielleicht sogar militärisch überwachte) Grenzzaun ist dabei nur ein mögliches Regime zum Grenzmanagement. Unterschiedlich ausgeprägte Porositäten wären andere. Diese wären, zumal in Zeiten der globalen Flows, wie sie Scott Lash und John Urry vor Jahren analysierten, sicher interessanter.
Jede Grenze beinhaltet letztlich ihre eigenen Mobilitätsformen. Diese verdichten sich an einer Grenze und legen sich dort quasi zugleich offen. Der Architekt Teddy Cruz macht dies anhand der vielleicht krassesten Grenze der Welt vor, jener zwischen den USA und Mexiko. Cruz selbst arbeitet in der Grenzregion zwischen Tijuana und San Diego. Mit seinen Projekten an der (sic!) Grenze zwischen Architektur und Kunst hinterfragt er immer wieder die Absolutheit jener räumlichen Grenze. Er legt offen, dass dort natürlich diverse Übergänge stattfinden – in unterschiedlichem Ausmaß staatlich sanktioniert. „Legal, illegal, sch…egal“, wie die lebenskulturellen Grenzüberschreiter der 1970er Jahre proklamierten.
In Deutschland diskutieren wir ebenfalls gerade die Grenzen. Unsere. Die klassisch-nationalen. Peter Sloterdijk, ein Philosoph, der mich eigentlich immer inspiriert hat und dessen „Weltinnenraum des Kapitals“ eigentlich einen phantastischen Lobgesang auf Grenzüberschreiter darstellt (die großen See-Entdecker nämlich), propagiert plötzlich in einer seltsamen neokonservativen Wandlung die kulturelle Bedeutung der nationalen Grenzen.
Ich frage mich nur, warum. So wie Sloterdijk Grenzen versteht, sind sie tatsächlich nur noch Abwehrmechanismen einer verängstigten Gesellschaft. Man duckt sich hinter den Zaun und hofft, dass nichts rüberschwappt. Ulf Poschardt hat Sloterdijk dafür zurecht als antiliberal kritisiert. Die Angela Merkel-Doktrin sehe in Grenzen nur noch einen Anreiz, sie zu überschreiten, kritisiert Sloterdijk. Ich glaube, mit diesem Befund hat er sogar recht – aber zu kritisieren ist das nicht. Tatsächlich sind Grenzen immer der erste Schritt zu ihrer Überschreitung. Hier agieren Gesellschaften nicht anders als Kids, die neugierig und frech über die Zäune ihrer Schulhöfe klettern. Der Moment der Grenzüberschreitung bietet ein befreiendes und gesellschaftlich produktives Moment. Etwas Neues entsteht. Darin liegt doch gerade der Reiz einer liberalen, offenen Gesellschaft. Gerade weil das Leben mit einer einmal porös gewordenen Grenze komplizierter wird.
Die klar demarkierte Welt ist eine weniger komplexe. Das ist es, was die verunsicherten und dauernervösen Massen an den diversen symbolischen und realen neuen Grenzzäunen unserer Tage so attraktiv finden. Wobei – „attraktiv“ ist als auch ästhetisch konnotierter Terminus vielleicht so falsch wie kaum ein anderer. Es ist ja doch bemerkenswert, wie hässlich die Grenzen dieser Welt immer sind. Das bis heute unübertroffene Beispiel ist natürlich die Berliner Mauer. Sie war nicht nur selbst von selten übertroffener Hässlichkeit, sondern dekonstruierte zugleich noch die gesamte Geschichte der Stadtplanung und Raumentwicklung einer Metropole brutal. Die Hässlichkeit der Grenze ist das unterdrückte schlechte Gewissen der Grenzzieher. Sie wissen eigentlich, dass sie aus einem unsouveränen Negativimpuls heraus handeln. Dieses Wissen drücken sie in einem unbewussten Akt der Selbstbestrafung durch möglichst hässliche Grenzanlagen aus.
Ich sage nicht, dass die Überschreitung von Grenzen zu einer problemlosen Welt voller fröhlicher Nettmenschen (als Pendant zu den gerade verunworteten „Gutmenschen“) führt. Dass das nicht so ist, haben wir gerade am Kölner Hauptbahnhof gesehen. Ich glaube auch nicht, dass der einzelne Grenzüberschreiter ein großer Weltversteher ist oder notwendig eine positive politische Agenda mit sich trägt. Natürlich sind nicht alle Flüchtlinge nett oder auch nur demokratisch gesinnt. Und natürlich stellt speziell der mit der Migration aus Syrien oder dem Irak auch importierte Antisemitismus ein großes Problem dar. Ich glaube nur, dass es ein Zeichen einer erwachsenen Gesellschaft ist, mit der Komplexität der politischen Lage unserer Zeit anders umzugehen als mit der SchließungSchließung: Bezeichnet alle technischen Vorkehrungen zum Schließen und Verriegeln von Türen oder Fenstern von Grenzen. Und dass man, wenn einem tatsächlich nichts anderes als „Tür zu“ einfällt, zumindest immer im Hinterkopf behalten sollte, dass das immer der am wenigsten originelle Umgang mit einem gesellschaftlichen Problem ist.