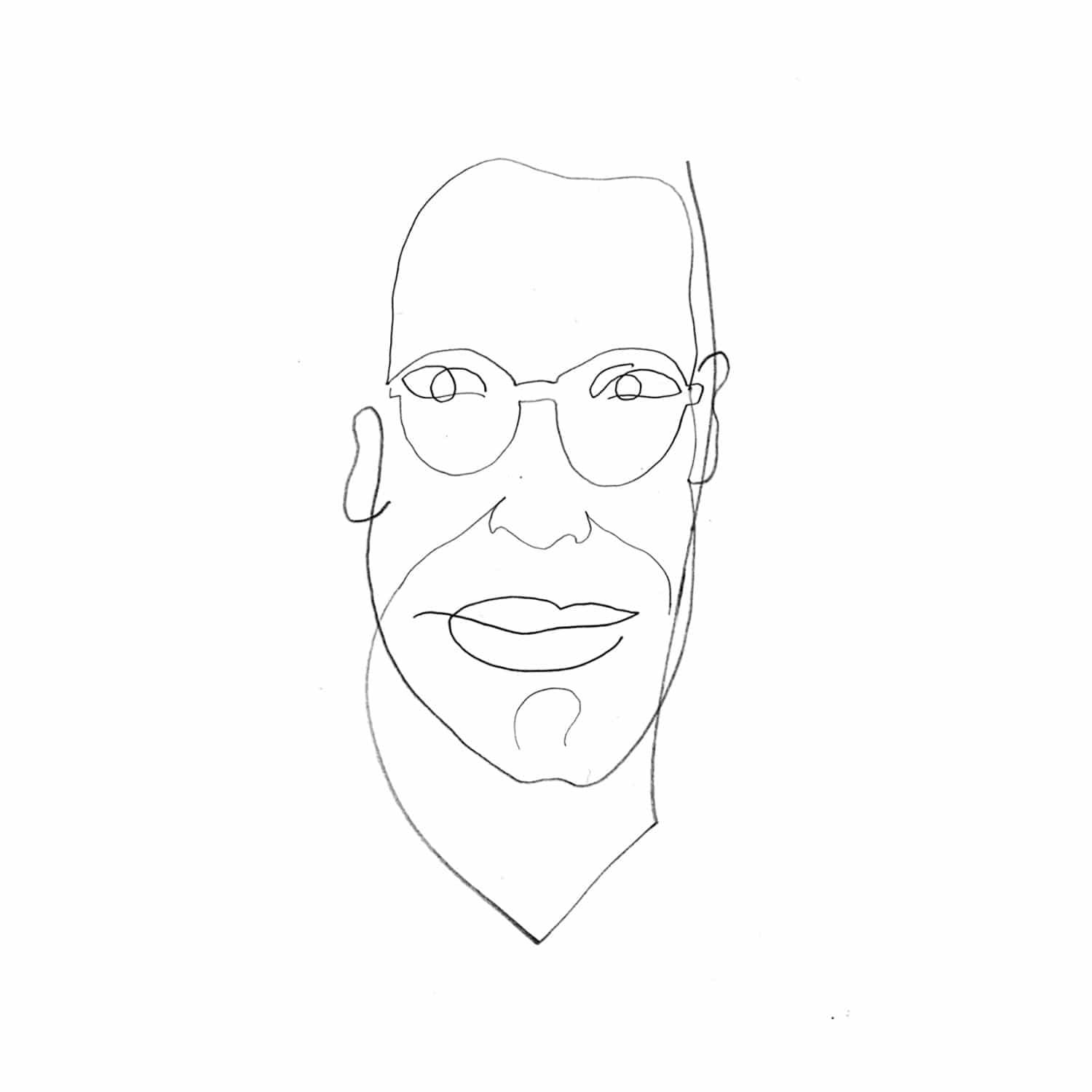Ein Wunder ist geschehen: Die Architektur hat es auf den Feuilleton-Aufmacher der Süddeutschen Zeitung geschafft. Na gut, das war jetzt übertrieben. Aber klar ist: Das Bauen hat es schwer in Publikumsmedien. Von daher gebührt dem Kollegen Matzig erstmal ein Kompliment.
Da schreibt er also unter der Überschrift „Unsere Stadt soll schöner werden“ einen langen Beitrag, und zwar über eine Werbekampagne von Hornbach. Die Baumarktkette hat offenbar zur großen Stadtverschönerung aufgerufen. Alle sollen mit anpacken und nicht nur bei sich zuhause, sondern auch gleich im öffentlichen Raum klar Schiff machen (und dabei natürlich Hornbach-Produkte verwenden). Der Gedanke behagt dem Autor nun gar nicht. Wenn die Masse regiert, kann nur Grausiges herauskommen, glaubt er. „Es könnte statt um Schwarmintelligenz auch im Schwarmdemenz gehen“, heißt es im Text, schön pointiert.
So weit, so nachvollziehbar. Was aber im zweiten Abschnitt folgt, gefällt mir gar nicht mehr. Da zeigt sich nämlich eine Grundschwäche architektonischer Diskussionen. Es wird mithilfe der üblichen Verdächtigen (Tom Wolfe, Alexander Mitscherlich, Ernst Bloch) der in seiner kulturkritischen Haltung nebulöse „die moderne Stadt ist hässlich“-Diskurs hervorgekramt. „Das Leiden am Raum ist schon längst Allgemeingut“, schreibt Matzig richtig. Nur: Er distanziert sich gar nicht davon, sondern macht sich diese Haltung zu Eigen: „Unsere Städte sind nicht (nur) deshalb so grausam, weil sie von unfähigen Stadtplanern und ignoranten Architekten ruiniert werden – sondern weil wir unseren Alltag nach Maßgabe der Billigkeit und Pflegeleichtigkeit und Wegwerfbarkeit der Baumärkte ruinieren.“ Also: Alles ist schrecklich, die Kulturskeptiker von Adorno bis heute haben Recht. Und daran ist neben, den anderen Nieten, der böse Kommerz schuld.
Warum langweilt mich diese Position? Zunächst, weil ich sie schlicht für überzogen halte. Unsere Städte mögen unperfekt sein, heterogen oder fehlgeplant. Aber grundlegend hässlich sind sie nicht. Die Pauschalablehnung dient der Selbstvergewisserung der Kritikerszene. Wer erst mal sagt, dass alles mies ist, der sichert sich unter Kollegen Respekt als einer, der „kein Blatt vor den Mund nimmt“. So funktioniert ein sich selbst stabilisierendes System.
Die These der schrecklichen Städte ist in einem Maße Allgemeingut, dass sie jeder der kritischen Beobachter auswendig aufsagen kann, selbst würde man ihn abrupt aus einem der Komas erwecken, in die er im Angesicht des Hässlichen immer wieder fällt. Das Gejammer über die ätzende Urbanität ist die Hymne der Architekturkritiker. Als Beleg werden meist Fotos öder Vorstädte herangezogen. Dann verfällt die Szene in einen besserwisserischen Kanon, der mal wieder so richtig die Dummheit der Welt attackiert. Nur man selbst weiß es natürlich besser – und die Buddies auf Facebook. Jede Wette: Der SZ-Text wird durch die sozialen Medien wandern, und alle werden liken, was das Zeug hält. So stiftet die Stadt als Negativobjekt vor allem eines: das kuschelige Wir-Gefühl derer, die einer Meinung sind.
Lustigerweise beschränkt sich die fundamentalkritische Haltung aber nicht auf diese Betrachterelite. Inzwischen steckt ein großer Stadtkritiker in jedem von uns. Das Gejammer ist zum Gemeingut geworden. Gerade hatte die Münchner „Abendzeitung“, kein Stammblatt linker Intellektueller, die hässliche Stadt zum Titelthema erhoben. Das passt. Die Pauschalanklage der bösen Stadt erlaubt es jedem Otto-Normal-Städter, mitanzuklagen.
Insofern ist die Hornbach-Kampagne nur der nächste Schritt. Werbung bündelt Volkes Emotionen und übersetzt sie in Produktbotschaften. Aus Werbegesichtspunkten also nur konsequent, was da passiert. Und wenn die Unterstellung stimmt, dass der normale Städter seine Kritik in handwerkliche Produktivität umzuwandeln in der Lage ist, so wäre das sogar irgendwie sympathisch. Vom Jammern zum Hämmern, sozusagen.
Vor allem aber ist die Werbung ja nur deshalb denkbar, weil es die pauschale Stadtkritik gibt. Insofern hätten die Kritiker genau jene Geister aus der Flasche gelassen, an denen sie sich nun abarbeiten.