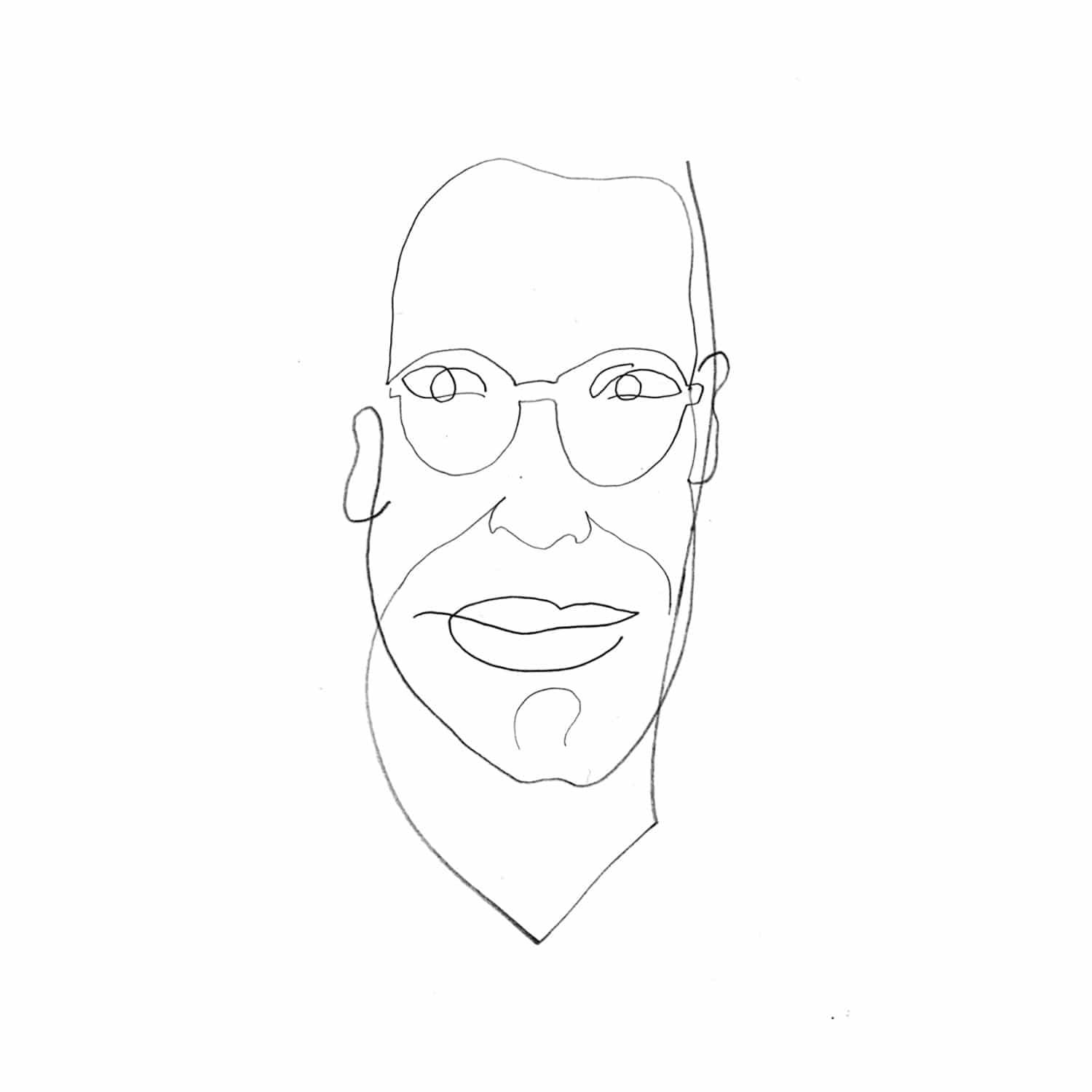Wenn es noch einen Beleg gebraucht hätte, dass die vermeintlich radikale Kulturwelt um die Berliner Volksbühne ihre eigenen Konservatismen pflegt, dann wäre der jetzt erbracht. Mit Chris Dercon bekommt die von ihrer eigenen Bedeutung überzeugte Bühne einen auf der Höhe unserer Zeit denkenden Kosmopoliten als Intendanten. Und die Volksbühnen-Nostalgiker nölen rum. Kein klassischer Theatermann sei er. Ein Argument, so voraussehbar wie langweilig. Systemtheoretisch lässt sich hier der Abgrenzungsversuch eines kulturellen Subsystems erkennen. Aus der Welt der Architektur kennen wir ähnliche Mechanismen. Verständlich sind sie, aber nicht besonders interessant.
Ein weiteres Argument der Traditionalisten: Dercon verstehe die spezifische Volksbühnen-Ästhetik nicht. Hier wird es schon etwas komplizierter. Denn das ist ja nicht falsch. Die Klischee-Reiterei einer sich radikal gebenden Globalisierungskritik, wie man sie von Pollesch und Co. kennt, ist unter Dercon nicht zu erwarten. Zum Glück nicht. Die Art darstellenden Gesellschaftsdiskurses, wie ihn die Volksbühne in der Vergangenheit hervorbrachte, war immer weit weg von der Wirklichkeit der globalisierten Welt. Produziert wurde ein Theater des frühen Nachwende-Berlins, eines dynamischen wie absurden Unortes, der zum real existierenden Kapitalismus genauso wenig zu sagen hatte wie zum Sozialismus gleichen Namens. Man arbeitete sich an den natürlich vorhandenen Mikro-Verwerfungen zwischen Tiergarten und Marzahn ab, gern angereichert um einen Blick auf Mecklenburger Skinhead-Clubs. Den fröhlichen Studenten aus der deutschen Provinz genügte dies.
Doch es reicht heute eben nicht mehr. Weil sich auch Berlin verändert. Die Stadt gerät ja, um mal die Sprache der Volksbühnen-Traditionalisten zu bemühen, tatsächlich in die Fänge des Kapitals. Etwa durch die vielen Startups, die sich in der Stadt gründen oder ansiedeln. Das tut ihr gut, weil sich damit mehr globalisierte Welt in Berlin spiegelt. Nur braucht es damit auch ein anderes Theater als eines, das sich primär mit dem Neuköllner Prekariat befasst. Es braucht eine neue Form der Kritik. Für die könnte Dercon genau der richtige Mann werden. Gerade weil er keinen Berliner Stallgeruch verströmt. Und auch weil er außerhalb Berlins mehr gesehen hat als darbende ostdeutsche Provinzstädte.
Und übrigens, da es in dieser Kolumne ja um Architektur geht: Auch dem Architekturdiskurs in der Stadt kann so jemand wie Dercon an der Volksbühne gut tun. Die diskursive Verengung auf die kritische RekonstruktionRekonstruktion bezeichnet die Wiederherstellung eines Bauwerks mit Hilfe von historischen Plänen, Fotos oder Skizzen, um es dem ursprünglichen Zustand möglichst nahe zu bringen. und ihre jeweiligen Unterwanderungen ist heute zu wenig. Das Theater muss zur baulichen Veränderung der Stadt eine offensive Haltung entwickeln. Mit Überzeichnungen hässlicher Investorenfratzen, wie sie Resultat der bisherigen Volksbühnen-Ästhetik wären, ist das nicht getan. Hinter dem, was in Berlin gebaut wird, steht ja nicht nur der gern zitierte „wild gewordene Kapitalismus“. Der hat mit der Hauptstadt ja immer noch seine Probleme; siehe den geplanten Wohnturm Frank Gehrys am Alexanderplatz, der nun ja offenbar doch nicht kommt. Es geht auch um die Befindlichkeiten der deutschen Kulturszene mit ihren oft diffusen, aber aufschlussreichen Erwartungen an die Repräsentationsfunktionen einer Hauptstadt. Hier traue ich Dercon spannende Interventionen zu – spannendere jedenfalls als Castorf und Co. In diesem Sinne: Mister Dercon, legen Sie los!