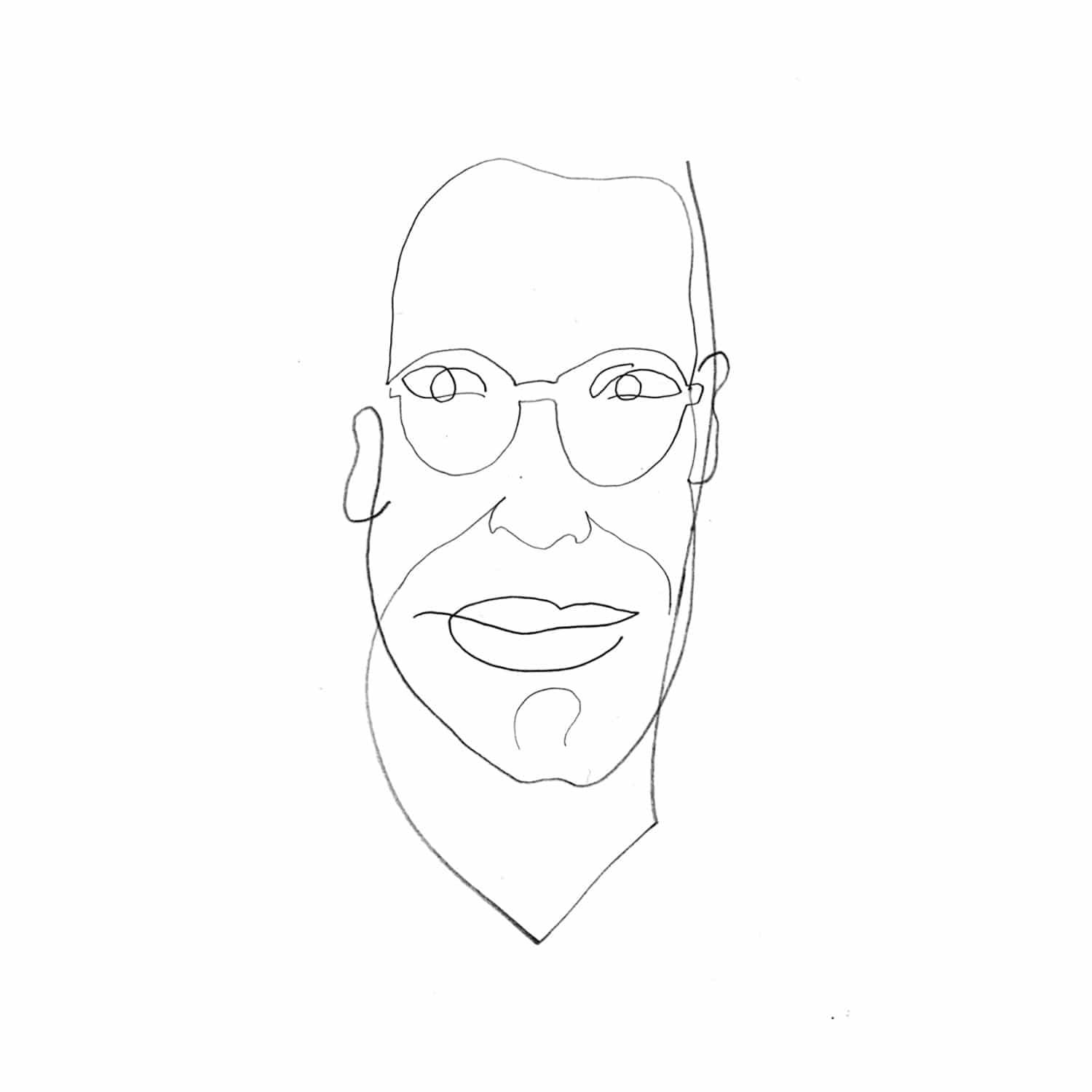Zunächst mal ist die „vertikale Stadt“ nur ein Gedankenspiel. Und doch muss, angesichts der radikalen Verdichtungsbewegungen in Ostasien, die Frage gestellt werden: Lassen sich reale urbane Qualitäten in Hochbauten erzeugen? Die Architekten von MVRDV haben sich das Thema schon seit längerem auf die Fahnen geschrieben – zuletzt in einer Ausstellung in Hamburg. Wir sprachen mit MVRDV-Chef Winy Maas und dem Leiter der Hamburger IBA, Uli Hellweg.
Baumeister: Herr Maas, unser Heft befasst sich mit der Frage, ob und wie vertikale Urbanität denkbar ist. Ihr Büro propagiert momentan das „Vertical Village“. Was verbirgt sich dahinter?
Winy Maas: In asiatischen Metropolen vollzieht sich im Moment eine radikale Transformation der Stadt. Stadtviertel, die in Jahrhunderten organisch gewachsen sind, werden in einem unglaublichen Tempo durch einheitliche Hochbauten ersetzt. Dabei verarmt das städtische Umfeld. Individualität geht verloren in dem monotonen Massenbau, der in erster LinieLinie: Die Linie ist der Begriff für die Kabelverbindung zwischen elektrischen Geräten und dem Stromversorgungsnetz. Es handelt sich dabei um den Strompfad, der den Strom von der Quelle zu den Endgeräten leitet. zwar ökonomisch erscheint und Wohlstand verspricht, aber im Endeffekt einen negativen Effekt auf die Stadt hat: sozial, demografisch sowie ökonomisch.
B: Gilt das für ganz Ostasien?
W M: Diese Entwicklung haben wir in Städten wie zum Beispiel Peking, Taipeh, Tokio, Bangkok, Jakarta und Singapur festgestellt und analysiert, aber es ist ein allgegenwärtiges Phänomen in ganz Asien. Wir haben junge Familien in Taipeh auf Wohnungssuche begleitet und gesehen, dass die in Massenproduktion gebauten Wohnungen nicht ihren Wünschen entsprechen, aber dass es für diese Familien keine erschwinglichen Alternativen gibt. Das ist problematisch, da diese Familien, sobald sie genug Geld haben, versuchen werden, ein Einfamilienhaus in einer weit entfernt gelegenen Vorstadtsiedlung zu kaufen. Dadurch entsteht „Urban Sprawl“. Verdichtung ist aber wichtig, da sie Chancen bietet, die Stadt nachhaltiger zu gestalten. Wir haben mit unserer Vision eines vertikalen Dorfs versucht, die guten Eigenschaften der innenstädtischen Viertel – diesen Kiez, den wir alle gerne mögen – mit Verdichtung zu kombinieren.
B: Stellt dies eine Erweiterung der Idee der „vertikalen Stadt“ dar?
W M: Es ist eine Humanisierung der Idee. Wir fügen soziale Elemente hinzu, natürliche Elemente und Individualität. Viele Projekte, die man heute als Modelle der vertikalen Stadt sieht, haben nur wenige dieser Eigenschaften oberhalb der vierten oder fünften Etage.
B: Herr Hellweg, wie erreicht man „vertikale“ Dorfqualitäten? Was muss hier die Architektur leisten?
Uli Hellweg: Ich denke, das Hauptproblem von Dörfern jeder Art – egal ob vertikal oder horizontal – ist das Verhältnis zwischen Privatheit und Öffentlichkeit. Dörfer legen auf Rollensind kleine bewegliche Teile, die in Türschlössern verbaut werden, um die Beweglichkeit der Türverriegelung zu verbessern. Sie können in verschiedenen Ausführungen und Materialien vorkommen. und Traditionen Wert; Städte erlauben Anonymität und Fremdheit. Man muss hier die Unterschiede in den gesellschaftlichen Strukturen und urbanen Traditionen zwischen Asien und Europa berücksichtigen. Bei uns ist die Stadt der Ort für Freiheit und Emanzipation.
W M: Ein Dorf in der Stadt bedeutet oft, dass man in einem anderen Haus wohnt als die Nachbarn, dass man eine demografisch variierende Nachbarschaft hat, dass man zum Bäcker laufen kann und in der direkten Umgebung vielleicht ein gemütliches Café hat und dass man die Menschen, die dort wohnen und arbeiten, zum Teil kennt. Wie kann man das künstlich erschaffen und auch noch bezahlbar halten? Wir denken, dass man neue Modelle des Bauens entwickeln muss. Die Architektur wird konsumentenorientiert und erfüllt individuelle Wüsche – vom Wohnen im Loft bis zum gestapelten Vorstadthaus. Mit Hilfe von Computermodellen und Prefab-Elementen wird es erschwinglich. Wobei die gesellschaftlichen Ersparnisse wie weniger Pendlerkilometer zum Beispiel mitgerechnet werden sollten
B: Werden unsere Städte künftig eher nach dem Modell Hongkong, Taipeh oder dem Modell Amsterdam funktionieren? Oder gleichen sich die Architektur- und Raumstrukturen weltweit betrachtet gar nicht an?
W M: Unterschiede werden bleiben, wir können aber von starken und schwachen Punkten lernen. Amsterdam ist wie viele der über 1000 europäischen Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern dank seines individuellen historischen Charakters eine sehr attraktive Stadt. Man sieht in Amsterdam, dass die höchsten Grundstückspreise in den historischen Stadtteilen im Zentrum erreicht werden und dass die Peripherie, die eher mit dem Modell Taipeh zu vergleichen ist, weniger geschätzt wird. Wir würden gerne eine hybride Entwicklung sehen, um die asiatische Verdichtung attraktiv zu gestalten. Im Moment ist die Realität aber anders.
U H: Urbanisierung ist heute ein globales Entwicklungsmodell. Das schließt seit 100 Jahren eine gewisse Internationalisierung von Stadtentwicklungsmustern ein. Typisch sind zum Beispiel die Suburbanisierung oder der Trend zu monofunktionalen Großsiedlungen und die Funktionstrennungen. Ich fürchte, daran wird sich solange nichts ändern, wie unsere gesamte Ökonomie und Gesellschaft auf der scheinbar grenzenlosen Verfügbarkeit von fossiler oder nuklearer EnergieEnergie: die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten oder Wärme zu erzeugen. basiert. Lokale oder regionale Architekturtraditionen spiegeln sich heute allenfalls in einer post-modernen Architektursprache.
B: Stellt die Idee der vertikalen Dorfstruktur für europäische Städte vielleicht auch eine Chance dar? Haben wir momentan zu viel Angst vor Vertikalität?
W M: Die Angst kann ja durchaus berechtigt sein, wenn es keine überzeugenden Beispiele für Vertikalität gibt. Auf städtebaulichem Niveau sind Hochbauten oft problematisch für die direkte Umgebung. Die meisten geliebten Hochbauten zeichnen sich vor allem durch ikonische Formen aus. Das ist an sich nicht schlecht, aber ist auch nicht genug. Es muss besser gebaut werden. Der Hochbau sollte typologisch und programmatisch revolutioniert werden. Davon kann auch die europäische Stadt profitieren.
U H: Vertikalität ist relativ und kontextuell. Grundsätzlich können unsere Städte wieder mehr höhere Häuser gebrauchen, weil sie wieder wachsen und wir nicht in die suburbanen Muster der „Oil-City“ zurückfallen dürfen. Entscheidend ist aber auch, wo die neue Verdichtung stattfindet: Im Rahmen der IBA haben wir ja im Leitbild „Metrozonen“ gezeigt, dass man an den inneren Peripherien der Stadt, in den Hinterlassenschaften der Wirtschaftsmoderne, auch lebenswerte Quartiere, neue Mischungen mit dichterer und zum Teil auch höherer Bebauung in schaffen kann. Was aber eine „Vertikalisierung“ unserer historischen Zentren betrift: Davon sollte man allerdings die Finger lassen.
B: In unserem Heft geht es nicht zuletzt auch um Bürohochhäuser wie das Londoner Shard. Werden diese künftig stärker auf Mischnutzung setzen müssen?
W M: Mischnutzung ist der Anfang einer Lösung, aber nicht radikal genug, um die Qualität entscheidend zu verbessern. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, das wir realisiert haben: in Oslo, wo ein ganz traditionelles Programm durch nur wenige Eingriffe entscheidend typologisch verbessert wurde. Ich spreche von der DNB-Bank, die uns gebeten hat, ihre ZentraleZentrale: Eine Zentrale ist eine Einrichtung, die in der Sicherheitstechnik als Steuerungszentrum für verschiedene Alarmvorrichtungen fungiert. Sie empfängt und verarbeitet Signale von Überwachungseinrichtungen und löst bei Bedarf Alarm aus. zu bauen, die vor allem aus flexiblen Bürogeschossen sowie Kantine, Konferenzräumen, Handelsparkett und Restaurant bestand. Anstatt wie üblich die Sonderfunktionen zwischen die Büroflächen zu packen, haben wir diese Räume über das ganze Bauvolumen verteilt und dann mit zwei halböffentlichen internen Straßen verbunden. Natürlich läuft fast niemand 17 Etagen nach oben, aber nach unten schon, und auch zwei oder drei nach oben. Und was man unterwegs sieht, ist faszinierend, das Gebäude fängt an zu leben: Man sieht Kollegen in den Teeküchen, man sieht Kollegen arbeiten. Und man bewegt sich selbst. Man sieht Aktivität und ist selbst aktiv; es ist eine ganz andere Erfahrung als eine Fahrt mit dem Aufzug. Dazu kommt, dass alle Geschosse unterschiedlich sind und alle Geschosse Außenflächen haben. Wir gehen doch gerne mal ein paar Minuten raus an die frische Luft. Das gibt Energie, so kann man besser arbeiten. Das DNB-Gebäude ist zwar nicht gemischt genutzt, bietet aber mehr Qualitäten als die meisten gestapelten Büroflächen oder gemischt genutzte Hochhäuser. Auch auf städtebaulicher Ebene, da man die Aktivitäten auch von außen mitbekommt.
B: Herr Hellweg, um Hybridität geht es auf der IBA…
U H: Das Thema „Hybrid Houses“ ist ein explizites Thema in der IBA Hamburg. Dazu wurden einige Beispielhäuser gebaut. Das Problem der Hybridität in der Praxis ist zum einen das deutsche Bau- und Planungsrecht; denn sobald Sie ein Haus für Wohnen und Arbeiten bauen, müssen Sie sämtliche Bauvorschriften, Stellplatzverordnungen und DIN-Normen für Büro- und Wohnnutzungen einhalten. Das verteuert das Ganze erheblich. Bei uns funktioniert die Multitalentiertheit von Gebäuden nur klandestin.
B: Gehören damit die monotonen Bürosiedlungen (wie auch die Londoner City) der Vergangenheit an?
W M: Das wäre wünschenswert, ist aber wenig realistisch. Wir brauchen jedoch Zukunftsvisionen wie das Vertical Village und positive Beispiele in der Architektur und im Städtebau, um die Disziplin als Ganzes weiter zu bringen, um bessere Städte zu schaffen und den Bewohnern freie Entfaltung zu ermöglichen. Das ist wirklich ganz dringend notwendig!
Mehr dazu im Baumeister 10/2013
Fotos: Katharina Wildt, Jeroen Musch, Rob´t Hart