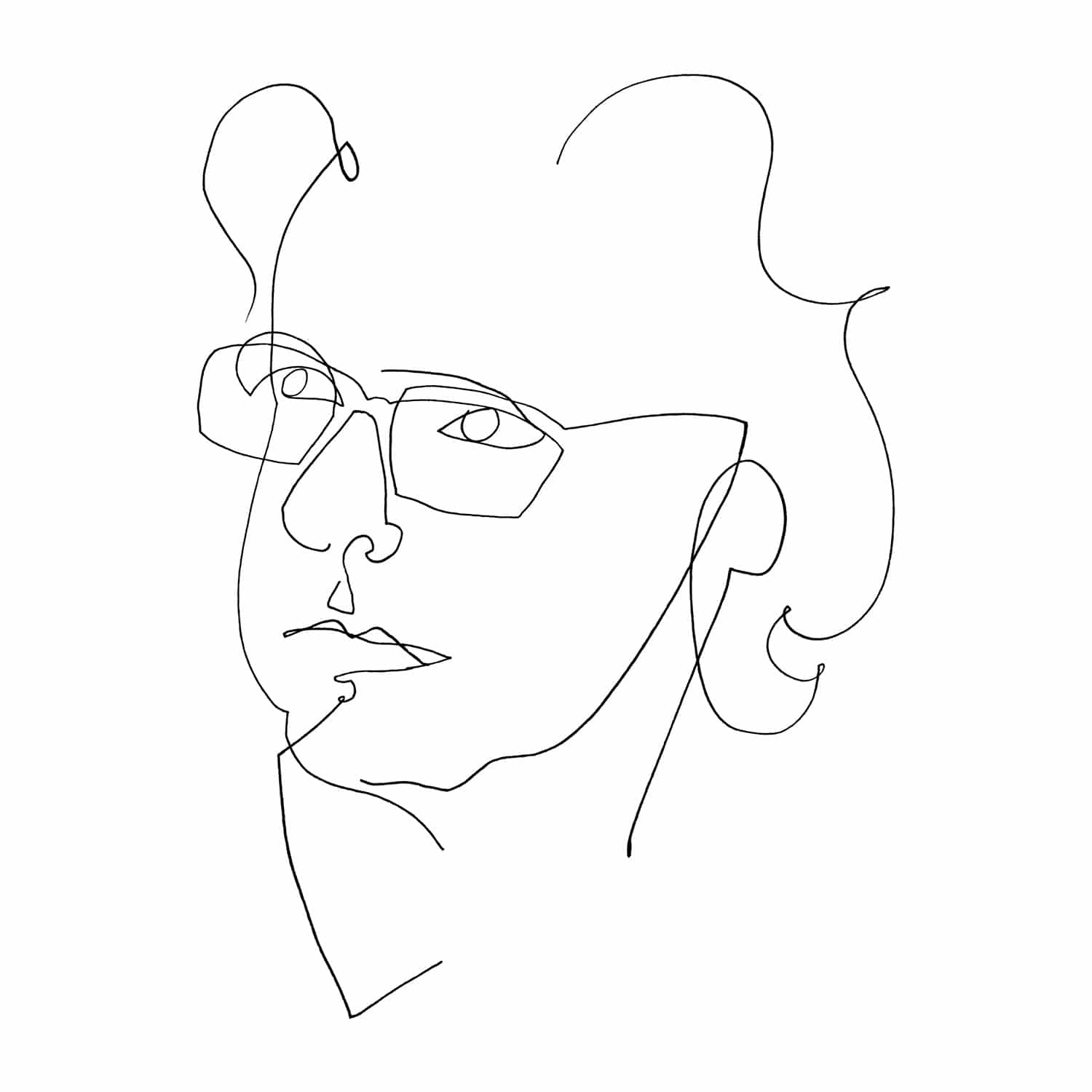Home, not Shelter!
Die Hans-Sauer-Stiftung engagiert sich im Rahmen sozialer Design- und Bauprojekte. Wir sprachen mit Vorstand Ralph Boch über aktuelle Projekte und die Zukunftspläne der Stiftung.
In den letzten Jahren hat das Interesse an kritischen gesellschaftlichen Themen im Architekturdiskurs beträchtlich zugenommen. Eine Folge davon ist das wachsende Engagement von Stiftungen im Bereich sozial orientierter Gestaltung und Architektur. Die Hans-SauerStiftung ist eine solche gemeinnützige Institution. In München ansässig, tritt sie als Förderer von Projekten in Wissenschaft und Forschung sowie als operativer Partner im Rahmen sozialer Design- und Bauprojekte in Erscheinung. Ihr Gründer und Namensgeber ist der Erfinder und Unternehmer Hans Sauer, der nach dem Zweiten Weltkrieg in der jungen Bundesrepublik die Relaistechnik revolutionierte und für über 300 elektrotechnische und elektronische Patente verantwortlich zeichnet. Im Jahr 1989 verkaufte er seine Firma, die SDS RelaisRelais – Ein Relais ist ein elektrisches Schaltelement, das zur Steuerung oder Trennung von elektrischen Stromkreisen eingesetzt wird. Es besteht aus einem Elektromagneten und einem Schaltkontakt. AG, und gründete die „Hans-Sauer-Stiftung für evolutionsorientiertes Erkennen und Handeln“.
Geleitet wird die Stiftung durch den Vorstand Ralph Boch und ein Kuratorium, dem auch Ursula Sauer, die Tochter des Gründers, angehört. Ganz im Sinne Hans Sauers und der von ihm formulierten Satzung hat die Stiftung die Themen Kreativität und Innovation im Fokus – bei gleichzeitigem verantwortungsvollem Umgang mit der Natur. Man versteht sozial und ethisch motivierte Innovation dabei als gesellschaftlichen und ökologischen Mehrwert und hat ein Interesse daran, wie sich Kreativität in einer vernetzten Gesellschaft entfaltet. Entsprechende Ansätze fördert die Stiftung mit dem Hans-Sauer-Preis, der alle zwei Jahre vergeben wird und abwechselnd Forschungsleistungen, Erfindergeist und gesellschaftlich-politische Best Practice-Lösungen honoriert, im deutschsprachigen Raum wie auch international.
Die Stiftung ist seit neuestem zunehmend operativ tätig und beteiligt sich mit ihren Mitarbeitern unmittelbar an Design- und Planungsaktivitäten, die mitunter Bauten zum Ergebnis haben, jedoch insbesondere das soziale Umfeld, in dem gebaut wird. Hierbei wird hinterfragt, wie interkulturelle Zusammenarbeit wirksam zu Innovationsprozessen beitragen kann. Im Rahmen solcher Prozesse gilt es, Kompetenzen zu entwickeln, die ökologisch und gesellschaftlich verantwortungsbewusstes Denken und Handeln unterstützen. Insbesondere durch die Realisierungsprojekte zur Schaffung integrativer Wohnformen unter dem Titel „Home not Shelter!“ im Jahr 2015 hat sich die Stiftung in der Architekturdisziplin einen Namen gemacht. Bauen wird hier als Ergebnis einer Gestaltung verstanden, die nicht zuletzt dazu dient, das Zusammenleben zwischen Menschen bereits vor dem Bau zu unterstützen. Wir sprachen mit dem Stiftungsvorstand Ralph Boch über das sozial orientierte Architekturverständnis, die aktuellen Projekte und die Zukunftspläne der Hans-Sauer-Stiftung:
“Wir wollten die Prozesshaftigkeit von Gestaltung als Inklusionsmoment nutzen.”
Baumeister: Wie sind Sie zur Stiftung gekommen?
Ralph Boch: Zur Stiftung bin ich über das Kuratorium gekommen. Das war seinerzeit noch geprägt von bundesrepublikanischen Industrielegenden wie Arthur Fischer oder Ludwig Bölkow. Ich bin dann über diese Tätigkeit in die Stiftung hineingewachsen. 2006 bin ich in das operative Geschäft gewechselt, und Ende 2011 hat man den Gründungs- und Wirkungsort Deisenhofen verlassen, ist nach München gezogen und hat dann programmatisch neu angefangen. Bei diesem „Relaunch“ ist das Thema „Gestaltung“ immer mehr in den Mittelpunkt gestellt worden. Wir glauben, dass eine gestalterische Herangehensweise auch im Sinne von Architektur in der Lage ist, gesellschaftliche Veränderungsprozesse anzustoßen. Und wir versuchen, solche Prozesse, in denen Gestaltung zu Veränderung führt, zu moderieren und zu initiieren.
B: Wie haben Sie die Flüchtlingskrise 2015 erlebt?
RB: Wir können uns als Stiftung selber beauftragen, wenn wir der Meinung sind, da draußen ist eine gesellschaftliche Herausforderung, die bearbeitet werden muss. Und so ist 2015, wie in weiten Teilen unserer Gesellschaft, auch das Flüchtlingsthema in unser Blickfeld gerückt. Wir haben damals aus einem Kreis heraus angefangen, der stark von Gestaltern mitgeprägt gewesen ist. Darunter waren auch Architekten, und wir haben bei der Initiative „Home not Shelter!“ das Thema Wohnen und Unterbringung fokussiert. Dabei wollten wir die Prozesshaftigkeit von Gestaltung als ein Inklusionsmoment benutzen.
“Die Art zu arbeiten, wie wir es tun, erfordert ein bestimmtes Mindset der Beteiligten.”
B: Bieten sich bestimmte Orte für diese Projekte an? Ist eine Stadt eher geeignet?
RB: Damals hat zu unserer Programmatik gehört, wir wollen in die Stadt, wir glauben an die Stadt als Integrationsmaschine. Am Ende sind es dann Opportunitäten, nach denen man sich orientiert. Bei einem Projekt in Wien war es die Caritas, die gesagt hat, sie müsse eine Flüchtlingsunterbringung betreiben und möchte da besser sein als eine reine Gemeinschaftsunterkunft herkömmlicher Machart. Das zu kombinieren mit einem Studierendenwohnheim war ein Thema. Ein Immobilienunternehmer hat sich ein Gebäude im 10. Bezirk gekauft, und der konnte sich eine Zwischennutzung vorstellen. Und dann hatten wir die Studierenden auf akademischer Seite. Schließlich wurde eine Reihe von Spendern dazu geholt. Die Schaffung solcher Konstellationen ist typisches Projektgeschäft für die Stiftung.
B: Bei Ihrer Arbeit können Sie auch zur Harmonisierung von Konflikten beizutragen. Die Idee nachhaltiger Stadtplanung ist ja, durch Inklusion potentielle oder bestehende Konflikte zu harmonisieren. Etwa, wenn ein Akteur einen Konsens erwirkt. Wie trägt man dazu bei, wenn nun ein Architekt initiativ auftrittAuftritt: Die Fläche, die der Nutzer betritt, wenn er die Stufe betritt. und einen Partner wie die Stiftung hat?
RB: Diese Art zu arbeiten, wie wir es tun, erfordert ein bestimmtes Mindset der Beteiligten. Wir sind der Meinung, dass wir immer besser darin werden, die Prozesse so aufzusetzen, dass sie eine entsprechende Kraft entwickeln. Und weil sie gerade von Stadtplanung gesprochen haben: Wir werden uns für die Stadt München im Rahmen des Perspektive-Prozesses mit der Stadtentwicklung bis 2040 beschäftigen. Was normalerweise ein verwaltungsinterner Prozess ist, werden wir mit einem selbst entwickelten, neuen Planungstool begleiten. Wir nennen das „Social Lab“. Es startet Anfang Oktober 2019 undist zunächst auf ein halbes Jahr angelegt. Hierzu haben wir eine Art Mini-Stadtgesellschaft nach einem sehr genauen Raster ausgewählt und zusammengestellt. Eine Fokus-Gruppe, die von uns in einen moderierten Prozess über mehrere Monate begleitet wird. Die Ergebnisse sollen in den etablierten Perspektive-Prozess der Stadt München einfließen. Wir haben dabei den Ehrgeiz, durch gute Prozessgestaltung eine größere Wirkung zu erzielen.
Wertstoffhof als Ort kommunalen Lebens
B: Können sie mir etwas zu konkreten, materiellen Projekten erzählen? Vielleicht eines, das mit Architektur befasst ist?
RB: Ein aktuelles Projekt hat mit einem anderen Förderschwerpunkt zu tun, den wir als „Circular Society“ bezeichnen und mit dem wir uns seit einem halben Jahr befassen. Das entstammt einer Nachhaltigkeits-Motivation, die beim Stifter übrigens auch sehr groß gewesen ist. Es geht dabei um die Frage, wie in unserer Gesellschaft Material- und Stoffkreisläufe geschlossen werden können, insbesondere, wenn sie noch nie geschlossen waren. Und dazu haben wir einen ersten Wettbewerb ausgeschrieben, der einen starken Designbezug hat. Ein darauffolgender, weiterer Wettbewerb, der Anfang November 2019 anlaufenwird, richtet sich explizit an die Architekturdisziplin und läuft unter dem Titel „Designing Circularity in the Built Environment“.
B: Gibt es auch Projekte, die schon umgesetzt wurden?
RB: Wir haben noch ein lokales Projekt, das hier im Umfeld von München angesiedelt ist, in Markt Schwaben. Die Arbeiterwohlfahrt ist auf uns zugekommen und hat angefragt, ob wir Interesse an diesem Projekt haben. Geplant war der Betrieb eines neuartigen Wertstoffhofs, wobei es zunächst darum ging, den bestehenden Wertstoffhof zu erweitern, in Verbindung mit einem sozial-integrativen Ansatz, den die Arbeiterwohlfahrt ja hat. Dann haben wir gefragt, ob sich nicht die Kommune ebenso wie die Arbeiterwohlfahrt dafür interessieren würde, über einen grundsätzlichen, neuartigen Ort im Umgang mit Ressourcen nachzudenken. Der Plan ging auf, und es ist wieder eine neue Konstellation entstanden. Das Projekt heißt jetzt „Mehrwerthof“. Anhand dieses Beispiels soll geprüft werden, ob es gelingen kann, von der Reparatur von Elektrogeräten bis zur Wiedergewinnung von Bauteilen neue, lokale Wege der Produktion und des Umgangs mit Ressourcen zu etablieren.
Materiallager mit lokalen Bauprojekten “matchen”
B: Man weiß ja, dass Wertstoffhöfe mittlerweile zu informellen Ortszentren geworden sind, wo sich Leute begegnen und unterhalten.
RB: Das war auch eines der Ausgangspunkte. Es gibt kaum einen Ort, wo sich die Leute so oft und zahlreich begegnen, wie auf diesem Wertstoffhof in Markt Schwaben. Daher kommt auch die Idee, ob der Wertstoffhof nicht zu einem neuen Ort kommunalen Lebens werden könnte. An sich ist dieser Wertstoffhof ein ur-linearer Ort, wo die Sachen zu Abfall werden, sobald man diese Schwelle übertritt. Gleichzeitig kommen hier diese privaten Abfälle erstmals lokal zusammen. Inwieweit kann das ein Ort der Reparatur werden? Kann man auf positive Art darauf zugehen? Ist es hier möglich, Reparaturcafés zu betreiben? Und jetzt kommen weitere Themen dazu: Kann das ein Ort sein, an dem produziert wird, an dem für lokale Bedarfe so etwas wie Stadtmöbel oder Möbel für öffentliche Gebäude produziert werden? Der Mehrwerthof wird der Prototyp dafür sein.
B: Wie setzen Sie das konkret um?
RB: Eine mit dem Projekt verbundene Gestaltungsaufgabe an Studierende der TUM bestand darin, Stadtmöbel unter Einbezug von Rezyklaten zu bauen. Das war wiederum der Katalysator, lokal Resonanztritt auf, wenn ein System auf eine bestimmte Frequenz eingestellt ist und auf diese verstärkt reagiert. Im Kontext der Akustik kann eine Resonanz in einem Raum auftreten, wenn bestimmte Frequenzen verstärkt werden und dadurch unerwünschte Raumresonanzen entstehen. und Öffentlichkeit für das Thema zu erzeugen. Die nächste Idee umfasst Bauteilewiederverwendung, da sind wir im Gespräch mit der Hochschule München. Es geht um die Inventarisierung von Gebäudeteilen und das „Matchen“ des Materiallagers mit lokalen Bauprojekten.
“Es gibt eine Bereitschaft zum Mitmachen, da ist Begeisterung da.”
B: Wie ist die Resonanz auf diese Projekte?
RB: Ich kann zwar nicht für die Mehrheit der Markt Schwabener sprechen, aber es gibt eine Bereitschaft zum Mitmachen, da ist Begeisterung da. Wenn man dort anfängt, für die Circular Society zu werben, hat man schon das Gefühl, das ist ein Thema für alle Generationen. Interessanterweise ist es besonders die ältere Generation, der – aus welchen biografischen Hintergründen auch immer – einleuchtet, dass man mit Ressourcen anders umzugehen hat. Wir haben aber auch, und das ist ein weiterer Punkt des Mehrwerthofs, hier einen Bildungsort. Da sind auch Schulprojekte beteiligt.
B: Was würden sie mit der Stiftung gerne machen, was sie bisher noch nicht gemacht haben?
RB: Ich glaube, die größte Herausforderung ist, das Modell, das wir haben, so weit zu formalisieren, dass es tatsächlich übertragbar ist, dass es für andere nutzbar wird, dass so eine Art „Social Design Paradigm according to the Hans-Sauer-Stiftung“ in die Welt kommt und auch Verbreitung findet. Ich glaube, dass es für alle möglichen gesellschaftlichen Handlungsfelder gelten kann. Wir sind unterwegs im Bereich Bildung, im Bereich Inklusion, im Bereich Zirkularität und arbeiten eigentlich überall mit den gleichen Methoden. Wenn es gelingt, dass wir das, was wir als Katalysator der Stiftungsarbeit verstehen, zu formalisieren, zu reflektieren, zu evaluieren und daraus ein übertragbares Modell zu machen, das wäre schön.
Dieses Interview erschien in gekürzter Form in der Ausgabe B12/2019 zum Thema Obdach.