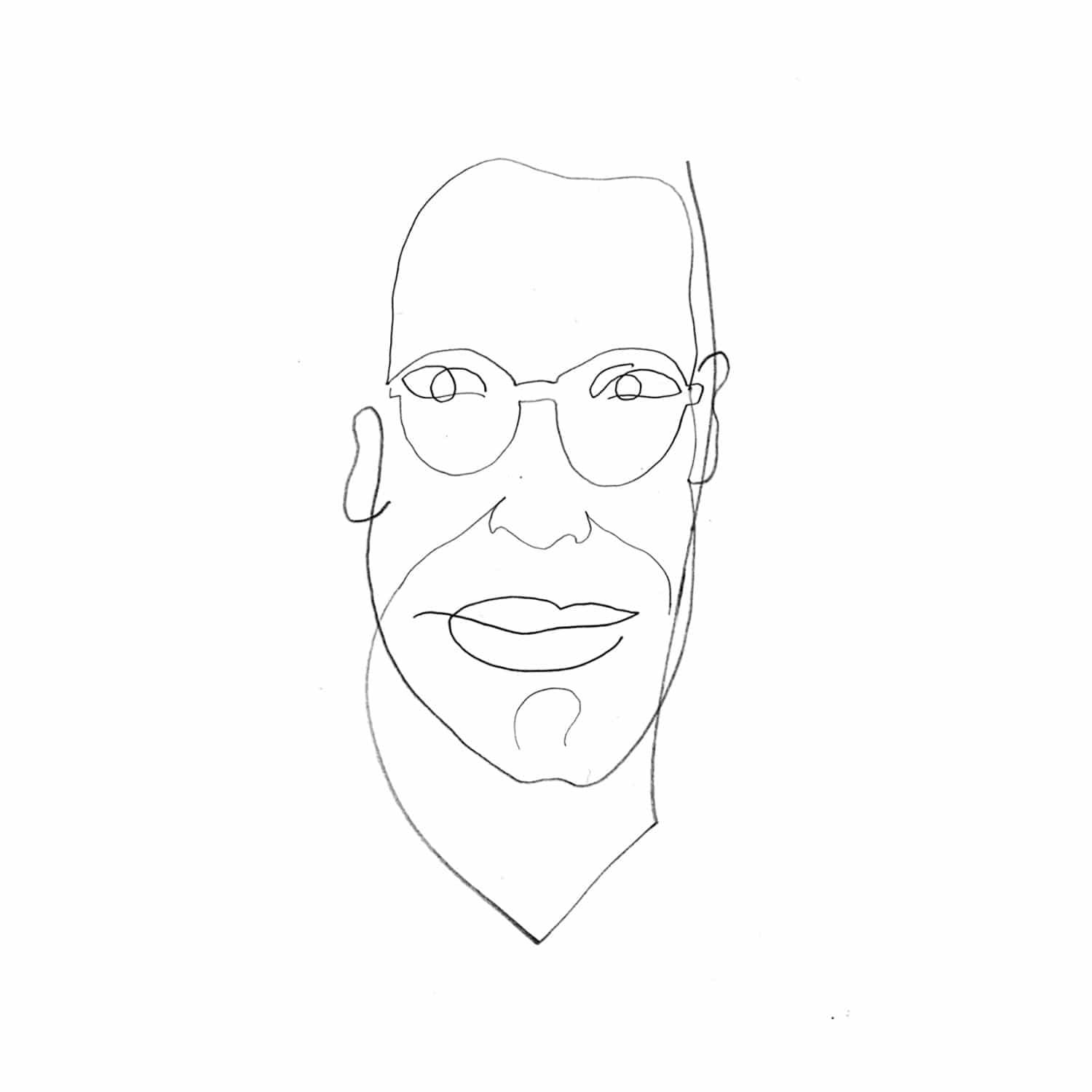„Time to say goodbye“ ist er betitelt, dieser immens kluge, weltreiche, brutal ehrliche Text, mit dem der Kritiker Fritz J. Raddatz das Ende seines journalistischen Schreibens begründet. Ein goodbye, das es in sich hat. „Ich habe mich überlebt“, schreibt Raddatz. Seine ästhetischen Kriterien seien veraltet, das Bestweck des Diagnostikers roste, die „Gierfreude am Schönen der Kunst“ (eine herrliche Formulierung!) sei zu Asche geworden.
Bezogen auf die Realität der Kultur- und gerade auch Architekturkritik, kann ich nur sagen: Wow. Nicht nur, dass Raddatz mit Sprache gewandter umgehen kann als der Durchschnitt unserer Zunft (allerdings auch als der gemeine Feuilletonist). Aber vor allem findet man so viel schonungslose Selbstreflexion selten. Raddatz argumentiert: Wenn einem die Welt um einen herum fremd wird, dann fehlen die Kriterien, sie angemessen zu diskutieren. Und wenn man keine Lust verspürt, sich mit dieser Welt neugierig auseinanderzusetzen, wenn einem also die eigene Haltung ständig heruntergezogenen Mundwinkel ins Gesicht drückt, dann wäre es egoistisch, diese Übellaunigkeit auch anderen zuzumuten.
Man muss sich die Raddatz-Radikalität nicht zu eigen machen. Und ehe das naheliegende Gegenargument kommt, Kritik brauche doch Distanz: Das weiß Raddatz natürlich. Er selbst ist einer, der stets Abstand herstellt – schon durch sein provozierendes Wesen. Er hat das ja explizit gemacht, zum Beispiel durch die Veröffentlichung seiner (ebenfalls ungemein lesenswerten) Tagebücher. Mit denen dürfte er – durch die gnadenlose Sezierung der Verhaltensweisen anderer – einige Freunde verloren haben. Es geht auch nicht um Distanzlosigkeit. Aber es geht um die stetige Neujustierung des eigenen begrifflichen Instrumentariums. Es geht darum, als Kritiker neugierig zu bleiben, nicht in Behäbigkeit zu verfallen. In die Dauerpose dessen, der mit ein paar vermeintlich wissenden Vokabeln glaubt, eine komplexe Realität diskutieren zu können. Und der sich doch nur um den eigenen, letztlich provinziellen Mikrokosmos dreht.
Ein Lieblingsbeispiel für mich momentan: der Begriff „Dekonstruktivismus“. Architekturkritiker werfen mit dem umher wie mit einem Flummi, jeweils deklarierend, das Konzept sei ja bekanntlich tot und folglich die Architektur, die vermeintlich in dekonstruktivistischem Mindset gebaut sei. Aber ein tiefes Verständnis dekonstruktivistischen Denkens liegt dem meist nicht zugrunde. Es ist nicht davon auszugehen, dass zuvor viel Derrida oder Deleuze gelesen wurde. Das Konzept wird zur bloßen Chiffre für alles, was zu schräg oder kontextlos daher kommt. Und daher bleibt die Wirkung die eines Flummis: Substanzloses Umherflippern.
Dieses Umherflippern ist Raddatz fremd. In diesem Sinne: Goodbye Mr. Raddatz. Your voice will be missed.